INHALT DIESER SEITE (BEITRÄGE IN REIHENFOLGE):
1. Im Räderwerk der Wirklichkeit
2. Über die Entstehung des Romans „Dieser Sommer in Triest“,
das Erzählen und die Parkinson-Erkrankung als Motiv
3. Aus dem Hinterhof - Kurzgeschichte -
4. Der Schriftsteller in freier Wildbahn - Eine Fragebogengeschichte -
5. Versuch über die Kurzgeschichte
6. Nummer 23 - oder: Unteilbar ist die Liebe - Kurzgeschichte -
7. Der Fluss, die Insel und das Flugzeug - Kurzgeschichte -
8. Leseprobe/Romanauszug aus "Lieber tot als Sklave", Kapitel An Bord der Schaluppe
mit Zustimmung des Wellhöfer Verlages, Mannheim (C) 2017
9. Die Geschichte der Entstehung meines ersten Schiller-Romans
10. Friedrich Schiller und der Blick in die USA - Die Mehrheit ist der Unsinn!
11. Vergangenheit und Zunkunft - Erzählung -
1.
Im Räderwerk der Wirklichkeit
Ich traue mir nicht zu, mit einem Roman die Wirklichkeit wiedergeben zu können, dafür halte ich die Wirklichkeit für viel zu vielschichtig und gewaltig. Die Wirklichkeit ist im Schicksalhaften noch viel anstößiger, undurchsichtiger, grausam und dubios, in der Art, wie sie ihre Opfer zurücklässt und in eine Zukunft davonschreitet, als ob sie in der Gegenwart nie die Spur der Mitverantwortung für ihr vergangenes Handeln übernehmen müsste. Ich stelle mit meiner Romanhandlung daher nie die Wirklichkeit dar – könnte es auch gar nicht – sondern stelle aus einem gewissen Blickwinkel auf das Geschehen, allenfalls für den Leser eine Art von Wirklichkeit her, damit er sich ein Bild machen kann. Für den Leser wird es am Ende kaum einen Unterschied machen, hat er erst einmal den Roman als Rahmen für die Wirklichkeit akzeptiert, wird die Handlung für ihn zu einer nachvollziehbaren Realität. Taucht er nur tief genug in den Fluss der Handlung ein, gelingt es mir als Autor, ihn mit Spannung, Gefühlen und Details sprachlich bei seiner Lektüre zu fesseln, könnte es durchaus geschehen, dass er sich sogar als Zeuge für ein Gerichtsverfahren über die wirklichen Geschehnisse verpflichten ließe und nicht einen Moment mit seiner Aussage zögern würde. Es soll solche Fälle bereits gegeben haben. Es soll dabei durchaus vorgekommen sein, dass der Roman, der mit der Wirklichkeit spielte, in der Gegenwart zum Maßstab für Schuld und Unschuld und aus dem fiktiven Spiel tödlicher Ernst geworden ist. Und es soll Fälle gegeben haben, in denen der Autor deswegen schließlich geteert und gefedert wurde und unter die Räder kam.
Doch, dass unser Wissen um die Wirklichkeit von Generation zu Generation weitergetragen wird, ist seit Jahrtausenden eine Aufgabe der Geschichtenerzähler. Die Menschen saßen in ihren Höhlen, gefangen in einer aussichtslosen Situation und draußen tobten die entfesselten Elemente. Mitten unter ihnen in der Dunkelheit, der Erzähler, der nach den Geschichten und ihrem tieferen Sinn greift. Das ist schon seit ewigen Zeiten so. Wir erzählen Geschichten, hören sie gern und gestalten damit unsere Wirklichkeit. Das Erzählen hat eine lange Tradition. Und zur Aufgabe der Tradition selbst möchte ich George Bernhard Shaw zitieren, der sie sprachlich in einem schönen Bild umrissen hat:
„Tradition ist wie eine Straßenlaterne in der Nacht, der Törichte umklammert sie voller Angst, der Kluge nutzt ihr Licht, um seinen Weg in die Dunkelheit zu finden.“
(2020)
2.
Über die Entstehung des Romans „Dieser Sommer in Triest“, das Erzählen und die Parkinson-Erkrankung als Motiv
Immer ist es der Einzelne, dessen namenloses Leben die Literatur sichtbar macht. Als Erzähler entziehe ich mich daher einer Verallgemeinerung; mir geht es daher nie um ein Allgemeingültiges Richtig und Falsch oder um die Krankheit als solche, von der über 200.00 Menschen in der Bundesrepublik Deutschland betroffen sind und die den Namen ‚Parkinson‘ trägt. Über die Krankheit, ihre Erscheinungsformen, die Betroffenen und ihre Behandlungen usw. ließen sich noch viele wichtige Sachbücher und Statistiken schreiben. Erzählend kann es mir nicht darum gehen, in Tagebuchform minutiös ein Leiden aufzuzeichnen, und in der eigenen Befindlichkeit zu verharren – was im Regelfall zu der berechtigten Frage führen würde, warum jemand anderer seine Lebenszeit für die Lektüre solcher Aufzeichnungen verschwenden sollte (wenn die Lektüre nicht ihrerseits wieder der empirischen Erhebungen für Sachliteratur dienen sollte oder der Leser zu dem Verfasser in einer besonderen persönlichen oder ärztlichen Beziehung stünde, was sein Interesse erklären könnte).

Beispiel: Ein Sachbuch mag die Stationen des Scheiterns einer historischen Persönlichkeit Schritt für Schritt dokumentieren und nachvollziehbar beschreiben. Von Bedeutung und wahr wird eine solche Beschreibung für einen Leser jedoch erst, wenn die Angst, die Trauer, das Entsetzen und die Sehnsucht dieser Persönlichkeit in einer konkreten Situation nachvollziehbar werden. Dies geschieht, wenn sie sich mit eigener Erfahrung, eigenem Erleben und eigenen Gefühlen des Lesers decken. Erst, wenn dieser Prozess in Gang kommt, enthüllt Literatur, macht sie auch bei historischen Geschehnissen bewusst, was wirklich geschehen ist. Hier kann manchmal die erzählte Spekulation oder Erfindung sogar näher an der historischen Wahrheit liegen als die Geschichtswissenschaft, der im Einzelfall der dokumentierte Zugang zur Gefühlslage und zum Ablauf von inneren Entscheidungsprozessen von Personen fehlt.
Für den literarisch arbeitenden Autor setzt diese Arbeit zwingend voraus, dass er sich die Sichtweise eines Einzelnen vollständig aneignet; er in dessen Existenz aufgeht. Dies gelingt ihm als Literat umso leichter, wenn sich Literatur engagiert. In ihrem Engagement, in dem ihr eigenen Aufbegehren des Einzelnen gegen den Lauf des Unrechts (oder wie im Roman „Dieser Sommer in Triest“, dem Verlauf einer unheilbaren Krankheit oder den kriminellen italienischen Familienstrukturen), beweist Literatur oftmals wahre Größe. Diese Größe der Literatur besteht in Demut. In Demut deshalb, weil dieser Kampf des Einzelnen gegen das Unrecht, die Krankheit und den Tod Teil unser aller Existenz ist und dieser Kampf niemals aufhört - und nicht endgültig gewonnen werden kann.
Das Scheitern in der Literatur hat deshalb nicht selten den Glanz des Heroischen. Mit einem Hauch dieses Glanzes und mit großem Anteil an Demut bin ich schreibend so älter geworden, mit „der Eselslast der Zeit und Krankheit auf dem Rücken“ (Ionesco), erzähle ich meine Geschichte. Und bevor im letzten Wartesaal des Alters u nd der Krankheit meine Kraft für die Fantasie versiegt, wollte ich mich von der Literatur überreden lassen, demütig immer aufs Neue daran zu glauben, dass diese, meine Welt zu retten oder zumindest zu verbessern wäre.
nd der Krankheit meine Kraft für die Fantasie versiegt, wollte ich mich von der Literatur überreden lassen, demütig immer aufs Neue daran zu glauben, dass diese, meine Welt zu retten oder zumindest zu verbessern wäre.
Diese Distanz, dieser Blick mit den fremden Augen auf ein Schicksal, das fremd ist, aber für dessen Entstehung und Dramatik man selbst die Fakten liefert, muss gewonnen werden, bevor das Schreiben an einem Roman beginnt. Von diesem Willen getrieben, über das, was mich in meiner Existenz getroffen hat, zu schreiben, bin ich neben mich getreten, habe ich mit den Augen der Viktoria Farber einen Blick über den Tellerrand der drückenden eigenen Befindlichkeit gewagt, mich in eine neue, mir fremde Umgebung begeben, um erzählen zu können, über Dinge, die ich damals für mich selbst noch nicht ganz in ihren Auswirkungen verstanden und in den Griff bekommen hatte und die auch heute nicht in Gänze fassbar und gestaltbar wären für mich.
So konnte ich dort lachen und weinen, wo ich es zwar wusste, dass jedes Aufbegehren gegen die Krankheit und das Alter chancenlos bleiben wird, das Leben aber dennoch Antworten (wie auf die Liebe, unsere Zukunft, unsere Bereitschaft, für etwas einzustehen und Verantwortung zu übernehnen), selbst auf jene Fragen, die wir uns nicht mehr stellen, abfordert und dabei noch nicht einmal eine Zumutung ist, sondern eine geschenkte Aufgabe, ein sich wiederholender Refrain der Zeit.
Dies wäre dann auch schon der Kern, auf den die Romanhandlung hinausläuft. Das chancenlose Aufbegehren und die nie endende Suche nach den großen Antworten auf die Fragen des Lebens, aufgeschrieben mit den Gedanken und Gefühlen des einzelnen Protagonisten der Erzählung, vorgetragen auf der Bühne des Lebens, der Wirklichkeit und der Fakten. Schreibend und vorlesend bitte ich um Nachsicht, da ich meine Instrumente für diesen Refrain der Zeit beständig stimme, um das Leben mit seinen wundervollen Möglichkeiten so lange es geht zu besingen und ihm gerecht zu werden. Die Fakten allein hätten mich verzweifeln lassen, die Erzählung hat mir zumindest neue Perspektiven und die Möglichkeit eröffnet, die eigene Unzulänglichkeit mit fremden Augen nachzuempfinden, um mich wieder „wahr“-zunehmen. Das positive Ergebnis möchte ich mit einer schlichten Wilhelm Raabe Äußerung zum Alter kommentieren: „So schönes Wetter – und ich noch dabei!“ (2019)
3.
Aus dem Hinterhof
Das Gras gekämmt, die Halme gebürstet, nach Süden ausgerichtet und angetreten, denn es ist Juni und die letzten Tropfen an der Regenrinne werden von der Sonne zerschmolzen. Schnell die Stühle gerückt, ein farbloses Tischtuch zum Himmelblau mit Kopfkissenbezug und kleinen sauren Schäfchen. Ob der Dünger wohl schon?, erschreckt ein Gedanke im viel zu grellen, farblosen Licht. Man fegt die Mauern und spritzt die fetten Schnecken weg. Blumenfeine Striche vor den Scheiben. Die Bäume schlottern im warmen Wind und die Erinnerung lässt zum Pinsel greifen: Augenbrauen wie Regenbögen werden vom kalten Mauerwerk aufgesaugt. Der Blick, wie durch Milchglas auf die Kaffeetafel. Allein, es ist schon schwer, den Hut abzusetzen, die Jacke auszuziehen und mit den nackten Füßen auf der Terrasse zu stehen. Irgendwo hört man noch Stimmen sterben, und wilde Tiere, vom gelenkten Sturz der Himmelskörper aufgeschreckt, flüchten ins Haus. Man wird Fallen aufstellen müssen, denn im Traum werden sie mit ihren zotteligen Fellen zu nächtigen Ungeheuern. Man atmet tief und in den nächsten Minuten fällt die junge Haut gerötet in kleinen Schuppen vom Körper. Es gibt kein Wohin. Den öligen Glanz der Spülmittel auf den Händen, sprachlos die Finger in den Briefschlitz der Nachbarn gesteckt, in der Hoffnung, dass jemand anbeißt, mit dem man reden könnte. Die Glocken läuten, die Tür muss verschlossen werden. Der Magen schmerzt von unbekannten Aromastoffen. Geschmacklose Erinnerung vor dem Tablettenschlaf, die Sonne brennt hinter dem Vorhang, der Tag ohne Ende. Irgendwo raunt noch ein Motor, und das Gift für die Apfelblüten verströmt einen süßlichen Geruch. Dann Gedanken an anderswo, den beklebten Koffer unters Kopfkissen geschoben und beim Wispern der Schlangen schläft man ein. Es ist alles in Ordnung. Mehr nicht.
(1990)

Udo Weinbörner, Autorenportrait privat
4.
Der Schriftsteller in freier Wildbahn
Eine Fragebogengeschichte
„Ein Mensch wie Sie hat es gut, wissen Sie das?“ In seiner Stimme schwang ein Vorwurf mit. „Jeden Tag auf den Weg zur Arbeit, des Morgens in der Dunkelheit in überfüllten Vorortzügen, abends mit der Last der unerledigten Aufgaben müde zurückkehren. Sie schreiben? Ist das Arbeit? Wann schreiben Sie denn tatsächlich?“
Er hasste es, sich rechtfertigen zu müssen. Doch nichts fürchtete er mehr, als die Stille, wenn er allein vor seinem Schreibtisch hockte und die Nachbarn zur Arbeit gefahren waren. Er stellte sich den Wecker, um noch am frühen Morgen ein paar tröstliche Worte zu wechseln. Und jetzt das! Schon bereute er es, früh vor die Tür getreten zu sein. Er versuchte, freundlich zu antworten. „Neulich“, sagte sein Gegenüber, neulich habe er ihn schon am frühen Morgen im Garten flanieren und träumen gesehen.
„Auch das gehört zum Schreiben“, antwortete er kleinlaut und schämte sich für den Eindruck, den dies erwecken würde. Noch mordete er nicht, noch rann kein Blut über seine Manuskriptseiten. Entschlossen, seiner Antwort Nachdruck zu verleihen, ging er wieder ins Haus, sein langes, scharfes Küchenmesser zu holen. Sein Blick auf die Wanduhr, er notierte im Kalender: Arbeitsbeginn 6:30 Uhr.
Als er mit dem Messer in der Faust wieder vor die Haustür trat, waren die Nachbarn längst flüchtig. So würde das nie etwas mit dem Genrewechsel ins blutige Fach. Er eilte in sein Arbeitszimmer, las Hemingway und dachte dabei an überfüllte Vorortzüge. Das wenigstens würde seinen Stil schulen und ihn beruhigen.
Sein Mitbewohner, der pockennarbige Kosslowski, die Hauptperson in seinem historischen Räuberroman, stand verlottert und verlaust im Türrahmen des Arbeitszimmers und grinste breit: „Na, Herr Schriftsteller, bei der Arbeit? Letzte Nacht, ein wildes Gelage und der Brand auf einem Hof. Dass er mir nicht zu blutleer wird, der Herr Stubenhocker mit den tintigen Fingern!“ Dieser Mensch hob drohend den Zeigefinger und lud ihn ein, das frische Diebesgut im Keller zu besichtigen.
Arbeitszimmers und grinste breit: „Na, Herr Schriftsteller, bei der Arbeit? Letzte Nacht, ein wildes Gelage und der Brand auf einem Hof. Dass er mir nicht zu blutleer wird, der Herr Stubenhocker mit den tintigen Fingern!“ Dieser Mensch hob drohend den Zeigefinger und lud ihn ein, das frische Diebesgut im Keller zu besichtigen.
„Warte nur, mein Lieber, bis es Abend wird!“, drohte ihm der Schriftsteller zurück. „Spätestens zwischen 19:00 und 22:00 Uhr jage ich dich mit dem Blau meiner Tinte über das Weiß des Papiers und mache dir die Räuberbraut mit ihrem tiefen Dekolletee und der schrillen Stimme abspenstig. Dann lebe ich gern wild und gefährlich, du kennst das ja!“ Der Schrecken stand Koslowski nach dieser Drohung ins Gesicht geschrieben und er versteckte sich einstweilen auf dem Dachboden.
Es wurde wieder grabesstill, der Kopf des Schriftstellers leer, und er füllte ihn mit den Buchstaben einer Morgenzeitung. Vielleicht sollte er verreisen. Eine Recherche. Diesen Teil der Arbeit liebte er, fand sich gewichtig dabei und wurde auf den verschlungenen Pfaden seiner Neugierde ernst genommen. Seufzend dachte er an die leere Geldbörse in seiner Jacke. Nein, zuerst musste er Rechnungen schreiben, sich um Termine für Lesungen bemühen. Geld musste her.
Vorwurfsvoll blickte ihn der Stapel weißer Seiten an, die es noch zu füllen galt. Blockade? Womit sollte er nur anfangen? Das Telefon klingelte. Ein Freund: „Schreibst du gerade? Sitzt du im Arbeitszimmer? Wo habe ich dich erwischt?“ Schriftsteller erzählte von den Nachbarn und dem Küchenmesser. Schon hörte er den wohlmeinenden Rat: „Geh mal raus. Unter Menschen, schreib in freier Wildbahn! Verkriech dich nicht an deine Lieblingsplätze in Haus und Garten und mache es dir nicht zu bequem. Du weißt, das bekommt deiner Sprache nicht. Raus mit dir, du faule Sau!“
Schöne Freunde hatte er! Die Faust geballt, bedankte er sich artig für diese guten Ratschläge. Wild entschlossen, bestieg er den überfüllten Vorortzug, fand keinen Sitzplatz und kritzelte fast unlesbar, halb im Stehen, halb gequetscht, zugemüllt von leeren Gesprächen und Handygeklingel, Worte, ja sogar ganze Sätze auf das Papier seines Notizblocks. Tauchte ab, wollte sich nicht gemein machen mit diesen sich aufdrängenden Selbstdarstellern der Arbeit. Was ging ihn die Beziehungskrise der kleinen Dicklichen an? Warum glotzte er auf das Display, das einen nackten Unterleib der Wochenenderoberung feilbot? Wie auf einem Hexenbesen raste sein Füller durch eine ferne Gegend und wärmte sich an einer wahren Liebe. Na, geht doch! Wäre doch gelacht, wenn nicht noch eine überlaute Gaststätte irgendwo? Seine Konzentration rebellierte, er schwitzte und kämpfte, die Seiten füllten sich. Am Abend hockte er vor dem Computer, verzweifelt bemüht, aus der unleserlichen Schrift und den ungeschliffen Formulierungen den Zusammenhang zu erschaffen, der ihm eines Tages zu Reichtum verhelfen könnte.
„Wie kannst du nur den Überblick behalten? Dieses Chaos, du verzettelt dich!“ Neulich hatte ihm seine Frau einen Ratgeber geschenkt: ‚Simplify your life‘. Er hatte ihn gelesen und sogar damit begonnen, aufzuräumen, einen riesigen Stapel von Büchern auszusortieren und sich von einer Unzahl von Projekten zu verabschieden. Sie meinte es wirklich gut mit ihm!
Doch kaum kehrte sie ihm den schönen Rücken, tauchte dieser pockennarbige Koslowski mit seiner ganzen Karbousche, diesem ganzen verlotterten und lärmenden Gesindel auf und scherte sich einen Teufel um jede göttliche Ordnung. Wie sollte der Schriftsteller da nur den Überblick bewahren? Aus purer Verzweiflung erwuchs ihm die Kraft, dem Chaos zu widerstehen, einen jähen Schlusspunkt unter die Erzählung zu setzen und sich von diesen lästigen Mitbewohnern zu trennen.
Doch schon am nächsten Morgen saß irgendein zwielichtiger neuer Geselle mit am Frühstückstisch, und seine Frau wollte nicht glauben, dass er diesen Burschen wieder in seinem Arbeitszimmer schlafen ließe.
Der Schriftsteller beeilte sich. Hastig holte er Straßen- und Landschaftskarten aus den entlegensten Winkeln seines Arbeitszimmers hervor, breitete diese auf diversen Tischen aus und beugte sich mit seinem neuen Gast darüber, um mehr  von seiner Herkunft und seinem Schicksal zu erfahren. Im Internet fand er alte Bilder und der neue, ungebetene Gast begann zu erzählen von Hungerszeiten und Kindertagen, Kriegsnächten, wilden Liebschaften und langen Wegen über das Eis der Berge und durch die sandigen Ebenen des Nordens und Südens. Ja, das wäre eine Geschichte! Überglücklich hing der Schriftsteller dem Fremden an den Lippen. Auf großen Blättern versuchte er, mit Skizzen die Zeitabläufe, Ereignisse, Wege und flüchtige Gedanken festzuhalten. Wie ein Ertrinkender bei Sturm auf hoher See entstanden seine Skizzen.
von seiner Herkunft und seinem Schicksal zu erfahren. Im Internet fand er alte Bilder und der neue, ungebetene Gast begann zu erzählen von Hungerszeiten und Kindertagen, Kriegsnächten, wilden Liebschaften und langen Wegen über das Eis der Berge und durch die sandigen Ebenen des Nordens und Südens. Ja, das wäre eine Geschichte! Überglücklich hing der Schriftsteller dem Fremden an den Lippen. Auf großen Blättern versuchte er, mit Skizzen die Zeitabläufe, Ereignisse, Wege und flüchtige Gedanken festzuhalten. Wie ein Ertrinkender bei Sturm auf hoher See entstanden seine Skizzen.
Der Nachbar klingelte und hinterließ eine Nachricht, als der Schriftsteller nicht öffnete. Er müsse eine Rede halten und ihm fehlten die Worte, stand auf einem Zettel. Schriftsteller kritzelte verärgert auf das Papier, er möge in den Garten gehen und träumen, faltete dieses zu einem Papierflugzeug und warf es aus dem Fenster seines Arbeitszimmers im ersten Stock Richtung Nachbargrundstück, wo es sanft bis zur Terrasse segelte.
Ob er bitte heute Abend den Müll…? „Die gelbe Tonne, diese Woche!“, rief ihm seine Frau zu, als sie das Haus verließ, nicht ohne den Fremden noch einmal misstrauisch anzuschauen.
„Welcher Müll?“
„Unrat, Pestilenz“, antwortete der Fremde, „Ratten, riesenhafte Viecher, die dir den letzten Bissen Brot streitig machen und dir die Ohren abbeißen, sobald du dich zum Schlafen legst.“ Das Grausen ließ ihn frösteln. Er griff zum Äußerten, zum Füller, richtete die Spitze, entschlossen, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen, auf die riesige Fläche des ungelebten Lebensblattes…, nicht jedoch, ohne zuvor doch…, einen Blick auf den Computerbildschirm...
Eine Kollegin versendet per E-Mail einen Fragebogen zur Arbeit und zum Leben des Schriftstellers. Die Fragen erreichen ihn noch, bevor er dem Fremden in sein finsteres Verließ folgt und an den Ketten der Autoren-Knechtschaft zerrt und rasselt. Wer kann in solch verzweifelter Lage noch am Computer hängen und Fragen beantworten? Warum und wozu? Die Freiheit will ans Licht und der Schriftsteller in die freie Wildbahn!
Ist der Fragebogen wirklich für ihn bestimmt gewesen, ein Licht in grausamer Finsternis? Die Kollegin fragt nach der schreibenden Einsamkeit. Den Schriftsteller dürstet, sein Hungerwolf, der kollert und schreit. Einsamkeit… schreit… Wieder ein Reim! Angewidert trollt sich der Fremde in eine Ecke und rollt sich in eine Decke, um am helllichten Tag gottserbärmlich zu schnarchen.
„Schreibe ich, arbeite ich, bin ich Schriftsteller?“, fragt der Schriftsteller ängstlich seinen Agenten, der ganz gut von der Hoffnung lebt, dass der Schriftsteller in freier Wildbahn, sich wild und gefährlich seinem frühen Dahinscheiden zu widersetzen versteht. Lebt…versteht… Schon wieder ein Reim…
Das mit dem Fragebogen zum Schriftstellerleben lässt er wohl besser sein, denkt er sich still und grinst gemein. Also schreibt er ihr: Frei bin ich nur auf dem Papier! Daher schreibe ich von aller Herrgottsfrüh bis nachts um vier, mehr sag ich nicht und hoffe, du verzeihst auch mir.
-------------------------------------------------------------------------
5.
Versuch über die Kurzgeschichte
Wer kennt den Platz zwischen Novelle und Skizze? Pardon, man liest heute Romane, Kriminalromane sogar. Kurzgeschichten sind vielleicht in Anthologien zu regionalen Mordansammlungen populär. (Und schaut man genauer hin, sind es am Ende dann doch Erzählungen.) Aber der Platz zwischen Novelle und Skizze … Muss das sein? Ich überlasse das Auffinden dieses Stuhls lieber den Literaturwissenschaftlern und nähere mich der Kurzgeschichte ganz profan als Handwerker.
Anhaltspunkt könnte hier der Umfang sein. Bei der Ausschreibung von Kurzgeschichtenpreisen wird die Kurzgeschichte bei einer Seitenzahl von drei bis maximal zwölf eingeordnet. Das entspricht ihrer Herkunft aus dem amerikanischen als literarische Gattung im Rahmen einer Zeitungs
Ein beliebtes Stilmittel der Kurzgeschichte und gleichsam der Ausgangspunkt für alle notwendigen Komprimierungen ist der sogenannte ‚jump in the story‘. Ein Protagonist tritt aus einem unerwarteten Augenblicksereignis in die Zeit der Erzählung ein. Mit seiner ersten Reaktion erschafft er die ihn umgebende Wirklichkeit. Dabei wird das entscheidende – auch der Komprimierung wegen – nach innen verlegt. Wendungen und Pointe der Geschichte werden vom Ereignis zu Anfang aus gesehen, über den gesamten Fluss der Geschichte verteilt und sichern so den Spannungsbogen. Eine Kurzgeschichte hält die Wirklichkeit in der Schwebe und endet deshalb häufig in unfertigen Schlüssen oder in einer Art ‚cliff hanger‘.
Den Kurzgeschichtenerzähler interessieren vor allem solche Ereignisse, die wie ein Stein, der ins Wasser fällt, Kreise ziehen und die so bedeutsam sind, dass der Protagonist Farbe bekennen muss oder gezwungen wird, sich infrage zu stellen. Er wird mit einer Wahrheit konfrontiert, die ihn im Moment,  hier und jetzt, innehalten lässt, die ihn zur Reaktion zwingt. Anstatt zu enden, hört die komprimierte Reaktionshandlung der Story einfach auf und überlässt Deutung und Interpretation dem Leser. Sie ist stets der Wirklichkeit zeitlos näher als dies die anderen Gattungen und Erzählhaltungen der Literatur vermögen. Sie ist ein Stück herausgerissenes Leben – was sie mitzuteilen hat, das macht sie in jeder einzelnen Zeile.
hier und jetzt, innehalten lässt, die ihn zur Reaktion zwingt. Anstatt zu enden, hört die komprimierte Reaktionshandlung der Story einfach auf und überlässt Deutung und Interpretation dem Leser. Sie ist stets der Wirklichkeit zeitlos näher als dies die anderen Gattungen und Erzählhaltungen der Literatur vermögen. Sie ist ein Stück herausgerissenes Leben – was sie mitzuteilen hat, das macht sie in jeder einzelnen Zeile.
Sie zeichnet sich durch eine Einheit in der Zeit, eine einfache Sprache und eine klare einheitliche Erzählhaltung aus. Alles Mittel der Verknappung und Komprimierung. Je näher die Geschichte in der Verknappung dem Protagonisten auf den Leib rückt, je engagierter und wirklichkeitsnäher gerät die Kurzgeschichte. Nicht der Mensch, wie er sein könnte, steht im Mittelpunkt der Erzählung, sondern der Mensch, wie er unfertig, mit Fehlern behaftet, ist. Die Kurzgeschichte zwingt den Autor zur Wahrhaftigkeit und macht ihn, wenn sie gelingt, authentisch erlebbar für seine Leser.
Immer wird dem Autor wichtig sein, wie sein Protagonist handelt. Seine Handlung, nicht seine Gedanken stehen im Vordergrund. Dialoge, falls sie überhaupt vorkommen, werden nur angerissen, untertreiben raffiniert, denn in jedem Satz schwingt eine Andeutung mit. Nichts wird erklärt, das allermeiste aber ausgelassen. Keine Parallelhandlungen, keine Nebenpersonen, die selbstständig eingeführt werden, die Geschichte wird ausschließlich von der Hauptperson her gesehen. In ihr wird jeder Satz wichtig, jede Handlung bekommt ihre Bedeutung – gerade auch wenn sie banal ist. Da die Kurzgeschichte nicht abwägt, sondern darstellt, ist sie besonders dort erfolgreich, wo sie soziale Missstände anprangert und sich engagiert. In der erzählenden Literatur ist sie sicherlich das dichteste und kunstvollste Wortgebilde, das jeden Schriftsteller irgendwann herausfordert. Ihrer engagierten Ausrichtung wegen liebe ich sie sehr.
6.
NUMMER 23 - oder: Unteilbar ist die Liebe
- Kurzgeschichte -
Es musste doch für etwas gut sein, wenn man so aussah wie Vince. Wahl- und skrupellos verführte er als eloquenter Lügner die begehrenswertesten Frauen, koordinierte leidlich die Termine mit seinen zahlreichen Geliebten. Dabei bekannte er stets beim ersten Treffen, ein notorischer Lügner und unfähig zur Liebe zu sein.
Auch Jasmin jagte und begehrte er auf diese Art. Doch unmerklich faszinierte ihn etwas an ‚Jazz‘, wie er sie zärtlich nannte, das über das Körperliche hinausging. Es gelang ihr sogar, dass er seine Verhältnisse aufgab, um sie nach Lissabon zu begleiten. „Damenprogramm“, witzelte Jazz. Er befürchtete, sie würde sich falsche Hoffnungen machen, beschwor sie geradezu: „Ich kann mich nicht verlieben.“ Doch sie bestand auf der Reise: „Wir können uns ja danach trennen. Es wird zauberhaft, du wirst schon sehen.“
Obwohl Vince dieses weibische ‚zauberhaft‘ nicht wörtlich nahm, spürte er eine ihm fremde Ruhelosigkeit. Er zog Bilanz: Jazz war seine 23 Geliebte. Er ging die Reihe all der Frauen und Mädchen durch und fragte sich, ob es eine jede von ihnen wert gewesen war. Der Gedanke an ihre Verschiedenartigkeit erregte ihn nicht mehr, Vince fühlte sich müde und gelangweilt. Er nahm sich vor, künftig etwas wählerischer zu sein.

Unschlüssig, ob er noch mitreisen sollte, saß er ihr am späten Abend gegenüber. Doch schon erklärte Jazz lächelnd: „Es ist so schön, dass du nicht in mich verliebt bist. Ich hasse jede Art von Versteckspiel. Lorenz heißt mein kleiner Freund, den ich vor einer Woche aufgetan habe. Nichts Ernstes.“ „Hast du Lorenz von uns erzählt?“, wollte Vince wissen. „Warum nicht? Ich glaube, er war ziemlich eifersüchtig auf dich. Sei mir nicht böse, aber heute Abend brauche ich ein wenig Ruhe.“
„Selbstverständlich“, erwiderte Vince. Tatsächlich setzte ihm die Vorstellung von Jazz in den Fängen des Jünglings heftig zu. In dieser Nacht fragte sich Vince, ob auch er nur einen Ausschnitt aus Jasmins Synopsis eines Beziehungsgeflechts bildete, das bei ihm immerhin bis 23 reichte. Reichten ihre Beziehungen etwa über seinen Erfahrungswert hinaus?
Doch als sie am nächsten Tag gemeinsam im Hotel Mundial, in Lissabon eincheckten, war Vince der aufmerksamste aller Reisebegleiter. Sie entschwebten mit dem altehrwürdigen Elevador da Santa Justa, auf die Höhe der Altstadt, genossen den Ausblick auf den Tejo, aßen Fisch, gingen anschließend spät abends noch ins Brasileria und lauschten den Fadoklängen der Musikanten. Dann hatte es Jazz eilig, sie sprangen als letzte in die gelbe Linie 28 der Straßenbahn, die vor dem Hotel Mundial ihre Endstation anfahren würde. Die überfüllte Bahn war die preiswerteste Art einer Stadtrundfahrt. Noch in der Hast meinte Vince, statt der 28 auf dem Schild die Zahl 23 erkannt zu haben, aber eine solche Linie gab es nicht. Er maß der Sache keine Bedeutung bei. Im Mundial zog ihn Jazz aufs Zimmer, wo sie sich leidenschaftlich liebten.
Am Sonntagnachmittag wirken beide übermüdet, als sie auf dem Parca do Comércio vor dem Finanzministerium den Bus bestiegen, der die Konferenzteilnehmer zu einem Empfang ins 23 km entfernte Sintra befördern sollte. Königspaläste, Parks, die Sommerresidenz der Royals – und das um 1800 erbaute Café Paris mit seinen blauen Fliesen an der Außenfassade, das mit seinem vollverspiegelten Raum, Kronleuchtern, edlem Tafelsilber einen stimmungsvollen Rahmen abgab. Der Spiegelsaal war für den Stehempfang vorbereitet, durch die angrenzende Bar, gelangte man in den weißen Salon, der für das Abendessen eingedeckt war.
Vince, nur Begleiter, beobachtete Jazz und fragte sich, was sie zu seiner 23 Geliebten hatte werden lassen. Die letzte Nacht der Leidenschaft schien etwas in ihm ausgelöscht zu haben. Ich kenne sie doch gar nicht, dachte er, betrachtete sich in den uralten Spiegeln des Raums und spürte Unbehagen, mit ihr ins Hotel zurückzukehren. Vince begann, nach Weißweingläsern zu greifen, ohne sich betrinken zu wollen. Dann bemerkte er, wie sie über einige Entfernung in seine Richtung deutete. Das Licht der Kristallleuchter brach sich zusammen mit den rötlichen Strahlen der untergehenden Sonne in den 
Im weißen Salon fand Vince in der hintersten Ecke der Tafel Platz. Seine Tischnachbarn waren freundlich, aber fremd, ausgelassen und laut. Kurz darauf betrat eine junge Frau den Raum und begann mit einem der Männer ein Gespräch. Sie war eindeutig anders als die anwesenden Frauen, jünger, hübscher, besaß einen aufregenden dunklen Teint, sie trug weiße Turnschuhe und ein luftig schwingendes Sommerkleid. Ein weiteres Gedeck kam. Sie aß mit gutem Appetit. Vince starrte sie an. Eine gutaussehende junge Frau, hungrig und freundlich, selbstbewusst genug, zu speisen, obwohl sie nicht zu den geladenen Gästen gehörte. Sie parlierte mit diesem und jenem drauflos. Vince war fasziniert, alle anderen weiblichen Wesen verblassten neben ihr. In seinem Kopf begann der Jagdinstinkt sein altes Spiel und ließ ihn binnen weniger Minuten einen Entschluss fassen. Vince musste diese Frau kennenlernen! Er entschuldigte sich bei Jazz, er wolle noch ein wenig umhergehen, mit dem Taxi zurückfahren. Es war verblüffend, wie überzeugend ihm die Lügen über die Lippen kamen.
Als Vince die Gesellschaft vorzeitig verließ, sah er für einen kurzen Moment die schöne Fremde ganz in der Nähe von Jazz stehen. Täuschte er sich? Vince wartete im Schatten einer Seitengasse. Nach wenigen Minuten erschien die junge Frau ohne Begleitung und lief die Straße hinauf. Dort befand sich an einem Berghang inmitten eines großen Parks in etwas mehr als 1 km Entfernung der 1900 errichtete Palast Quinta da Regaleira. Vince hielt Abstand, bemüht, sich ihrem Schritttakt anzupassen. Ihr helles Sommerkleid hob sie stets deutlich von den Schatten der Hauswände ab. Bald hatten sie den Ortsrand passiert. Vince entschloss sich, den Abstand zu verringern. Jeden Moment konnte sie in einem Eingang verschwinden. Sie musste ihn doch mittlerweile bemerkt haben!
Vince erkannte tatsächlich jenseits der Mauern den Palast und die Parkanlage, die geschlossen waren. Verblüfft blieb Vince einen Moment stehen. Da ging sie auf das Tor zu, das tagsüber den Besuchern als Ausgang diente. Der Klang eines Schlüsselbundes! Er folgte ihr im Laufschritt. Das war überfallartig! Keinesfalls sollte sie ihn aus Furcht abweisen. Er hielt Abstand, sodass er nicht als Bedrohung begriffen werden konnte, erklärte in
„Sie sind mir gefolgt.“ Nur eine Feststellung von ihr, keine Frage. Vince glaubte, dass sie es auf dieses Treffen angelegt hatte. Er war jetzt ganz bei sich: Blitzschnell denken, ein Raubtier auf der Jagd. „Ich musste dich kennenlernen. Ich heiße Vince.“ Ihr Gesicht im Halbschatten nur undeutlich zu erkennen. „Du bist unwiderstehlich schön.“
„Was macht Ihre Frau heute Abend?“
„Ich war nie verheiratet, aber – zugegeben: meine Begleiterin fährt zurück nach Lissabon.“
„Sieh an, sieh an, Vince, wenigstens sind Sie klug genug, mich nicht anzulügen. Übrigens, Antonia. Ich arbeite im Museum.“ Sie trat ins Mondlicht. Vince starrte wie hypnotisiert in ihre dunklen Augen. „Was ist nun? Wollen Sie mit rein?“ Wieder entschuldigte er sich. Sie verschloss das Tor hinter ihnen.
Vince riskierte alles: „Also, ich bin nicht gebunden und möchte lieber mit dir schlafen.“ Antonia starrte ihn ein wenig sprachlos an. Das war schon ein krasser Satz. Dann lachte sie: „Wenigstens ehrlich, Vince. Die Wievielte wäre ich?“
„Ist das wichtig, …?“, wunderte sich Vince.
„Für die 13 wäre ich zu abergläubisch – als 10 würde ich mich leichtfertig fühlen. Wie steht es mit Liebe und Wahrheit?“, Antonias Hand berührte ihn auf der Schulter. Für einen Moment dachte er intensiv an Jazz und ihm war wieder bewusst, warum er sich in sie verliebt hatte. „Aufrichtige Antwort: Nummer 24. Von Liebe war nie die Rede.“ Sie verwundert: „Ohne Nachzurechnen, was ist davon zu halten?“
„Ich habe Anlass gehabt, Bilanz zu ziehen. Warum sollte ich nicht mit dir schlafen wollen? Du bist begehrenswert“, antwortete er mit großem Ernst.
„Warum denn nicht …“, sagte Antonia, was keine Frage war, aber in ihrer Betonung auch nicht wie eine Antwort klang. „Ich gehe ein Stück voraus. Fremde sollten hier jetzt niemandem begegnen, Vince.“ Sie ging in einem weiten Bogen links vom Schloss durch den nächtlichen Park, bevor sie sich dem oberen Eingang näherten. Schatten und Licht auf dem Weg narrten offenbar die Wahrnehmung. Antonia war schnell unterwegs. Vince, bekam Schwierigkeiten, den Anschluss zu halten und meinte einige Male, sie schwebe die Parkwege entlang. Eine gespenstische Atmosphäre. Tatsächlich lief er das letzte Stück, jede Vorsicht außer Acht lassend. Es hätte ihn verwundern können, dass die Türen weit offenstanden, aber er schaute nur Antonia hinterher, wie sie von der Dunkelheit des Hauses verschluckt wurde. Wenige Sekunden später stolperte er in einen Raum völliger Finsternis. Er sah nichts mehr von der jungen Frau. Er hörte auch nichts von ihr, keine Schritte, nicht ihre Stimme, keine Geräusche, nichts. Es herrschte eine Stille, wie sie auf dem Mars herrschen musste, wenn es dort tatsächlich still war. Vince verharrte in der Hocke lauschend. Dann gelangte er 
Im oberen Teil des Parks der Quinta da Regaleira gab es diesen großen geheimnisvollen Brunnen ohne Wasser. Eine Wendeltreppe führte über neun Ebenen auf den Grund hinunter. Dieser Brunnen sollte einstmals als Initiationsstätte für Freimaurer errichtet worden sein. Auf seinem farbigen Grund fand man am nächsten Morgen, den bewusstlosen Vince völlig nackt. Wer konnte schon sagen, was sich wirklich zugetragen hatte. Der Zwischenfall erregte Aufsehen, weil der Mann eine Vertreterin der deutschen Delegation begleitet hatte und beide noch während ihres Aufenthaltes in Portugal heirateten. Die Ausstellung im Palast über die 23 Variationen der Liebe wurde ein Erfolg. Die junge Künstlerin Antonia erklärte auf die Frage eines Reporters, warum sie 23 Variationen gewählt habe, der Zauber der Liebe brauche mehr als einen Versuch und die wahre Liebe sei unteilbar.
(c)2018 Weinbörner, Udo
7.
Der Fluss, die Insel und das Flugzeug
- Kurzgeschichte -
Ein Blatt Papier – rein weiß – unbeschrieben, welch ein Glück am frühen Morgen, wenn die Gedanken wandern gehen und alle Dinge grüßen wie am ersten Tag, als ließe mich die Erinnerung die Welt neu erfinden, setzen sich die Sätze zu mir, um mir von Geschichten zu flüstern, uralt, groß und herzerweichend wahr, die das Wasser des Schlafeflusses, dieses mächtigen Stromes der Träume teilen, genau dort, wo es all die Wege gibt, zu jenem rettenden Ufer, von dem man mir erzählte, wer dort auf der Insel heimisch würde, so sagte man, dem schiene die Sonne ewig.
Ich weiß, dass ich jetzt ernsthaft schreiben sollte, aber ich lasse die Geschichten an mir vorüberziehen, all diese ungelebten Tage, geboren von einer ungeheuren Sehnsucht auf der Welt. Unmäßig könnte ich werden, bei den erloschenen Farben in der Nacht und diesem Leben, das mich nie zu Atem kommen lässt, mit den ungezählten Büchern, die mit ihren Farben aus meinen Regalen quellen, um mir auf ewig ihre Treue zu schwören.
Es ist der zweite oder dritte Frühlingstag an einem Morgen, und er war bereits eine ganze Zeit lang Morgen, als das Flugzeug kommt, um mich zu holen.
So stirbt man also jeden Tag, inmitten von diesem Flüstern ungeschriebener Geschichten, wenn das Wasser zurückkommt, die Flut ist pünktlich und die Wege zu dem Ufer der Insel kaum noch zu erkennen. Bis Mittag bleibt mir noch Zeit genug für einen Versuch, das Überflüssige herauszustreichen, sodass die kurzen Sätze in einen perfekten Absatz passen, in dem sich endlich alles aufrichtig fügen könnte, wenn ich es nur richtig anfinge. Was habe ich nicht alles angestellt für ein wenig Luxus und Bequemlichkeit? Weißt du noch? Schreibe ganz vorsichtig. Überzeugt davon, ich kann das mit dem Absatz, auch wenn es an diesem Morgen ein wenig spät ist.
Sie haben mir tatsächlich dieses Flugzeug geschickt. Ich werde noch einmal meine geliebten Berge sehen und die Insel. Nicht jeder kann fliegen.
Ich steige ein, nehme mir vor, dankbar zu sein, ein guter Mensch. Vielleicht müsste es Regen geben, sage ich mir, als der Flieger abhebt und das ewige Blau den Himmel uninteressant macht. Als er an Höhe gewinnt und ich aus dem Fenster schaue, brummen die Motoren und alles, was ich geschrieben hatte, wird unter mir zu winzigen Punkten und Strichen.
(c) 2020 Udo Weinbörner
8. LESEPROBE aus:
"Lieber tot als Sklave/Die letzte Fahrt des Amrumer Kapitäns Hark Nickelsen", historischer Roman, Wellhöfer Verlag
An Bord einer Schaluppe
von
Udo Weinbörner
Eine Schaluppe ist ein kleines, einem Kutter ähnelndes Segelboot mit einem oder (seltener) zwei Masten, das oft als größeres Beiboot verwendet wird. In dem vorliegenden Abschnitt sind sieben Sklaven gefesselt an Bord und der Versuch der Weißen in den mitgeführten Fässern Trinkwasser aufzunehmen, ist vor zwei Tagen gescheitert. Auch die Bordverpflegung für die 10 köpfige Besatzung ist aufgebraucht. Man ist in einen Sturm geraten und hat Sichtkontakt zur Küste verloren. Es gibt einen vereinbarten Treffpunkt mit dem Mutterschiff, dem Dreimastsegler 'Vesuvius', aber man ist sich wegen der eigenen Position im dichten Nebel schon nicht mehr sicher. Die Männer unter dem Kommando des frischgebackenen Zweiten Offiziers der 'Vesuvius' sind bereit, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen, um ihr Überleben zu sichern. Die Verzweiflung ist grenzenlos – eine existenzialistische Ausgangslage.
Die Männer an Bord der Schaluppe sprachen nicht mehr viel, sparten ihre Kräfte oder ließen sich in depressiver Hilflosigkeit dem Ende entgegentreiben. Die Übrigen, welche die Stadien der Fantasien und Wahnvorstellungen bereits das erste oder zweite Mal hinter sich gelassen hatten, belauerten sich, bereit, Beute zu machen und um des Überlebens willen, jedem an Bord an die Gurgel zu gehen. Tade Rickerts und Ole Jessen gaben nicht auf. Im Wechsel saß einer von ihnen selbst auf der Ruderbank und pullte, während der andere, seine Waffe griffbereit neben sich liegend, das Boot überblickte und Kurs hielt. Aber auch sie fühlten sich längst gottverlassen und Zweifel nagte an ihnen, ob sie sich nicht geirrt hätten bei der Positionsbestimmung, bei ihrem Kurs, ob sie nicht längst Todgeweihte wären. Ein weiterer Tag in der Schaluppe, den Wellen preisgegeben und dem Wind, der seine Richtung wechselte und sie deshalb nicht rasch genug in die Nähe der Küste brachte. Ein Tag mit Sonne und brennendem Durst, dem unermesslichen Meer, das schläfrig machte, letzte Kräfte aufsaugte. Für Stunden zogen sie schließlich die Ruder ein, sparten Kräfte. Sie dämmerten im Halbschlaf auf dem Bauch, vermieden so, dass ihnen Möwen ins Gesicht pickten. Verdammt noch mal, wo Möwen waren, gab es eine Küstenlinie! Warum sahen sie diese nicht? Warum kamen sie nicht an? Dann war es Rickerts erneut, als ob er ein Geräusch gehört hätte. Er hob unter übermenschlicher Kraftanstrengung den Kopf, stemmte sich auf seinen Armen hoch und spähte über die Bordwand. Sah aber nur dieses glitzernde Meer, in dem sich Abertausende von Sonnenstrahlen brachen, deren Helligkeit in den Augen schmerzte. Am späten Abend vor Sonnenuntergang, stritten sie sich mit letzter Kraft und Rickerts lenkte ein, ließ sich, um des Friedens willen, zu einer Kurskorrektur überreden. Es wurde kühler, und bis in die Finsternis hinein griffen sie alle noch einmal zu den Rudern. Aber eine weitere bitterkalte Nacht brach über sie herein, ohne dass sie irgendwo angekommen wären.
Der nächste Morgen begann mit einer absoluten Flaute inmitten eines dichten, kalten Nebels. Irgendwo über ihnen musste die Sonne scheinen, aber sie konnten sie nicht sehen. Ole Jessen und Tade Rickerts blickten sich an und brauchten keine Worte, um zu wissen, dass dies ihr letzter friedlicher Tag sein würde. Mohr verteilte ein Schlafpulver, das er für Verletzungen in seinem Medizintäschchen mit sich führte. Mit diesem Pulver betäubte er jene, die ihm am aggressivsten schienen. Aber am Ende dieses Tages, der ohne Orientierung und ohne Hoffnung im Nebel begann, würde es nur noch ums nackte Überleben gehen. Rickerts kroch zur Mitte der Schaluppe, zog sich am Mast hoch, verschnaufte dort eine Weile, dann begann er, ein Kirchenlied zu singen: "Großer Gott, wir loben dich …!" So laut es ging und aus voller Brust sang er. Tatsächlich stimmten einige von der Mannschaft ein. Die Schwarzen suchten einen Rhythmus in den Versen, zu dem sie hätten klatschen können, fanden aber keinen und schauten mit großen Augen zum Mast hin, als hätten sie eine Erscheinung gehabt. Rickerts spürte, dass seine Beine wackelten, er wusste nicht, wie lange er noch dort am Mast stehen könnte, aber er sang und betete weiter und weiter. Niemand hinderte ihn daran, und seine Stimme wurde über die gekräuselten Wellen des Meeres in die Nebelwand hineingetragen. Während er so stand, sang und betete, funktionierte plötzlich sein Verstand wieder, es kamen und gingen sonderbare Gedanken, die er nicht gerufen hatte. ‚Der Weg auf dem Land ist fest und der Wasserweg ist wandelbar. Der Weg auf dem Land ist starr und unser Weg auf dem Wasser beweglich. Die Landwege sind genau bezeichnet, aber der Wasserweg auf dem Meer bleibt ewig unbekannt.‘ Er erinnerte sich an seine Unterrichtsstunde in Navigation – und Schifffahrtskunde bei einem alten ehemaligen Kapitän in Föhr, wie dieser aus dem Handbuch der Schifffahrtskunst zitiert hatte [nach Martin Cortés]. Er hatte sein Leben auf eine Illusion begründet, auf dem Wasser sein Haus gebaut! Er blieb ein von Gott verlassener Narr! "Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der aller treuesten Pflege, des der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde, gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann …" Den letzten Vers wiederholte er murmelnd, dann sank er zusammen und kauerte mit dem Rücken am Mast. Seine Gedanken arbeiteten an einer Liste, was er alles zu erledigen hätte, wenn er nach Amrum zurückkäme …
Der Tag, hoffnungslos wie der vergangene. Doch plötzlich kam eine frische Brise auf, war dort in der Ruhe, ein Aufziehen des Wetters zu spüren, die Wellen schlugen an der Bootswand hoch. Ole Jessen und Mohr kamen herüber, um Segel zu setzen. Rickerts blieb vor dem Mast sitzen und schaute ihnen zu. ‚Wie lange konnte man seine eigene Pisse noch trinken, wenn man absolut nichts mehr zu sich nahm? Vergiftete man sich irgendwann an sich selbst?‘ Gedanken dieser Art beschäftigten ihn jetzt, seit er Mohr ein Erfrischungsgetränk solcher Art hatte zu sich nehmen sehen. Vor ihm, Steuerbord voraus, war für einen kurzen Augenblick der Schein von Lichtern zu sehen gewesen. Ganz deutlich, als der Wind die Nebelwand aufriss. Dieser Lichterschein war sehr rasch wieder verschwunden und schon unwirklich geworden, als Rickerts blinzelnd genauer hinsah. Jetzt starrte er aufgewühlt weiter in diese Richtung. Vielleicht waren es Hütten, gar eine ganze Ortschaft? Er dachte nach. Oder es konnte auch ein Schiff gewesen sein. Denn es gab mehrere Arten von Lichter in einer Nebelwand, aber bei denen, die er gesehen hatte, handelte es sich größere Laternen. Bei einem Schiff mit solchen Laternen handelt es sich um kein Fischerboot. Je länger Rickerts darüber nachdachte, kam er zu dem Schluss, dass es dann ein Kriegs– oder Handelsschiff sein müsste, welches wie sie in Küstennähe führe. Waren es also die freundlichen Lichter einer Küstenlinie gewesen oder die mörderischen eines Schiffsriesen, der vielleicht in diesem Moment schon geradewegs auf sie zuhielt, um sie bei einer Kollision zu zermalmen? Wie irre begann er plötzlich: "Licht!", zu schreien: "Ich habe verdammte Lichter gesehen! Schiffslaternen! Steuerbord voraus!" Einige lachten wie blöde vor sich hin und meinten, es handele sich um einen schlechten Scherz. Manche hielten Rickerts schon seit Längerem für durchgedreht. Andere begannen zu grinsen. Die Soldaten griffen zu den Gewehren und schossen jetzt in die Richtung, in die er gedeutet hatte. Der Nebel schien die Schussgeräusche zu dämpfen und schließlich zu schlucken.
Mohr und Jessen krochen zu ihm hin: "Wo, Tade? Lichter? Sag schon!" Er deutete etwas vage nach vorn, irgendwo ins Ungewisse. Dann sahen auch sie die Lichter für wenige Augenblicke. Keine Frage, es musste sich um ein Schiff handeln, und es war näher gekommen, als Rickerts es angedeutet hatte. Ein Schiff, ein richtiger Brocken von einem Schiff, das wie sie in Küstennähe unterwegs war, bereit, ihnen den Garaus zu machen. Ein halbes Dutzend, wenn nicht gar mehr mörderische Lichter!
"Was meinst du, Ole?", keuchte Rickerts.
"Ich habe sie auch gesehen! Ganz deutlich! Ein großes Schiff! Was hat das zu bedeuten?" Die Bedrohung, die Mohr jetzt spürte, schien in ihm neue Kräfte freizusetzen und er reagierte aufgeregt.
"Ein verdammt großes Schiff wird uns in weniger als fünf Minuten vielleicht auf den Grund des Meeres befördern. Das könnte es bedeuten", antwortete Jessen und wurde kreidebleich dabei.
Rickerts hielt seinen Zeigefinger in den Wind, schätzte so Windrichtung und Windstärke. Auch ihre Schaluppe machte jetzt Fahrt. "Der Wind hat auf achtern angedreht", hörte Mohr jetzt den Ole Jessen sagen. "… Ein Handelsschiff, nehme ich an. Ganz sicher wird der Kapitän die Stagsegel streichen lassen, wenn er sie geführt hat. Er wird nicht zu viel Fahrt machen wollen, bei dem Nebel und in Küstennähe …"
"… bestimmt hat er auch die Segel am Großmast eingezogen, damit das große Gaffelsegel nicht auf das Ruder drückt und nicht den Wind aus dem Vortopp und dem Focksegel nimmt …", mutmaßte Rickerts und Ole Jessen ergänzte: "Ich denke, er hat nur das Gaffelsegel eingezogen und die Marssegel beigesetzt gelassen. Er hätte sich auch für das Losmachen des vorderen und hinteren Leesegels entscheiden können, wovon ich allerdings so früh am Morgen bei dieser undurchsichtigen Nebelsuppe nicht ausgehe."
Windböen pfiffen über die Schaluppe und knallten jetzt auch in ihr eigenes Segel. Der Nebel wurde weiter Richtung Land getrieben und riss in weiten Strecken auf. Jetzt sahen sie alle den übermächtig hohen Bug mit der Galionsfigur vorweg auf sich zusteuern, schon konnten sie die Masten zählen, die himmelhoch über ihnen emporwuchsen und vernahmen, wie das stolze Schiff, wie ein Messer durch die Butter, das Meer zerschnitt und die Wellen rauschend zur Seite nach hinten warf. "Sieh an, so schlecht haben wir gar nicht gelegen, bei der Einschätzung der Besegelung", Rickerts lächelte schwach. "Der Kapitän hat seinen Kahn so besegelt, dass er möglichst viel Fahrt macht und er dennoch im Nebel und in Küstennähe navigieren und loten kann. Gut der Mann!"
Mohr sprang auf, riss die Arme in die Höhe: "Verdammte Scheiße! Hört doch mal auf, über die Segel zu philosophieren! Wen interessiert jetzt eure Schifffahrtskunde? Unternehmt etwas! Ich glaube, die sehen uns nicht!"
"Das ist sogar ziemlich sicher", stimmte ihm Rickerts mit stoischer Gelassenheit zu. Jetzt reagierten auch die letzten Männer an Bord auf das Schiff. Jessen stammelte als Erster: "Großer Gott, das ist unsere 'Vesuvius'!"
Ausgerechnet ihr eigenes Schiff! Die meisten begannen jetzt auch ihre Arme in die Höhe zu reißen mit letzter Kraft zu schreien und zu gestikulieren. Die Soldaten feuerten Richtung Luftraum über das Deck des Schiffes. Rickerts kroch erneut zum Ruder und setzte zu einem waghalsigen Ausweichmanöver an. Dies würde sie zwar direkt aus dem Wind nehmen und das Segel vielleicht in den kräftigen Böen zum Teil in Fetzen schlagen, aber es blieb ihre einzige Chance, denn ein Schiff von der Größe der 'Vesuvius' ließ sich nicht wie ein Ochsenkarren zum Stehen bringen oder rasch auf die Backbord– oder Steuerbordseite zwingen. Mohr kroch heran: "Werden wir es schaffen?" Ohne das Ruder loszulassen, bereit, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen, antwortete Rickerts: "Wahrscheinlich nicht. Unser größtes Problem besteht darin, dass die 'Vesuvius', die uns nicht sieht, auf der Landseite fährt. Das wahrscheinlichste Ausweichmanöver wird für sie darin bestehen, auf das offene Meer zuzuhalten, um nicht zu nah auf die Küste zuzusteuern und Landberührung zu bekommen …" "Bei diesem Kurs werden sie aber auf uns treffen. Wir sind nicht schnell genug, ihr zu entkommen", führte Mohr den Gedanken zu Ende.
"Sie wird uns in weniger als drei Minuten über unseren Weg fahren. Und wenn wir Pech haben, einfach über uns hinweg", schlussfolgerte Jessen und winkte und schrie wie die anderen um sein Leben.
"Teufel noch eins! Die müssen uns bemerken!", fluchte Mohr. Er fand neben Jessen sogar noch die Kraft zu springen, während er seine Arme in die Höhe riss. Sie sahen die großen Bugwellen mit den weißen Schaumkronen des rasch dahinfahrenden Handelsschiffes auf sich zurollen. Dann entdeckten sie schemenhaft Matrosen an der Deckseite, die zu ihnen hinüber starrten. Sie hörten die langgezogenen Schreie des Ausgucks vom Hauptmast. Die weißen Wellenkronen der Bugwelle rauschten mächtig heran, während die 'Vesuvius' in buchstäblich letzter Minute Richtung Steuerbord beidrehte und majestätisch an ihnen vorbeiglitt, während sie ihrerseits wie ein verrücktes Zirkuspferd auf den Wellen des Meeres tanzten und zu kentern drohten. Atemlos von der Schreierei gerieten sie jetzt, hielten sich kaum noch auf den Beinen, und als die Wellen gegen die Bordwand steil emporschlugen, stürzten sie schwer, starrten an dem riesigen Schiff empor, das ihr gesamtes Blickfeld wie ein Berg einnahm. Die Männer in der Schaluppe verletzten sich bei ihren Stürzen, blieben zerschlagen, müde und stöhnend liegen. Aber sie waren nicht zermalmt worden! Es gab sie noch! Und wenn man sie an Bord der 'Vesuvius' bemerkt hatte, würde man die Segel einholen, das Schiff treiben lassen und mit der zweiten Schaluppe zu ihnen rausfahren, um sie zu bergen. Mit viel Glück waren sie jetzt gerettet! Rickerts wurde schwarz vor Augen und er ergab sich einer tiefschwarzen Leere und Müdigkeit. Ihm war gleichgültig, ob er jemals wieder aufwachen würde, und er fiel von jetzt auf gleich in einen Schlafzustand, der einer Ohnmacht ähnelte. Mohr und Jessen hockten bei dem Ruder, rissen ihre Augen weit auf und versuchten, solange es ging, das Heck der 'Vesuvius' nicht aus den Augen zu lassen. Sie verließen ihren Kurs und segelten dem Handelsschiff hinterher. Dabei nahmen sie das Risiko in Kauf, dass man sie vielleicht nicht erkannt oder nicht wirklich bemerkt hätte und weitergesegelt wäre. Dies hätte dann wirklich ihr Ende bedeutet. Harte Stunden bis zur Bergung und zur Gewissheit lagen noch vor ihnen …
© Udo Weinbörner / Wellhöfer Verlag, Mannheim
(Hinweis: Der Text wurde dem 2017 erschienenen Roman "Lieber tot als Sklave" über das Leben des Amrumer Kapitäns Hark Nickelsen entnommen und mit Genehmigung des Verlages zur Verfügung gestellt. Wellhöfer Verlag: Mannheim 2017.)
9. Die Geschichte der Entstehung meines ersten Schiller-Romans
Als ich im Jahr 1998 Weimar besuchte, geschah dies eher im Rahmen einer Stippvisite, denn meine Frau und ich wollten im Mai am Rennsteig-Marathonlauf teilnehmen. Ankommen war unser Ziel und so blieben wir von falschem Ehrgeiz verschont und besuchten am Tag vor dem Start Weimar. Die Stadt zeigte sich damals noch nicht von ihrer schönsten Seite, denn überall musste man fast buchstäblich "über Baustellen steigen". Viele Häuserfassaden und Dächer waren noch renovierungsbedürftig und überall herrschte Betriebsamkeit, die einen beschaulichen Rundgang in Sachen Kultur stets ein wenig störte. Im Jahr 1999 sollte Weimar nämlich als Kulturhauptstadt Europas in neuem Glanz erstrahlen. So wandelten meine Frau und ich ein wenig auf Goethes, Schillers und Wielands Spuren und machten - dies war die positive Kehrseite der Medaille - auch manch überraschende Entdeckung, die so heute nicht mehr möglich ist. Beispielsweise fanden wir uns anlässlich verschiedener Ausweichwege (der Baustellen wegen) auf dem Jakobsfriedhof mit der dazugehörigen Kirche wieder. Wir bestiegen die in bedenklichem Zustand befindliche Türmerwohnung unmittelbar bei den Glocken des Turms und blickten auf das Landschaftskassengewölbe, wo ich kurze Zeit später bereits vermuten sollte, dass sich Schillers sterbliche Überreste immer noch hier und nicht in der Fürstengruft befänden. Alles in allem beschlossen wir, Weimar erneut zu besuchen, um die Orte und Plätze der Weimarer Klassik und des Bauhauses einmal ohne Baustellen richtig zu genießen. Natürlich führte unser Weg damals auch ins Schiller- und ins Goethe-Haus und dort stieß ich im Andenkenshop auf einige Schiller-Zitate, die Goethe zugeschrieben wurden, der, was die museale Aufbereitung anging, damals auch wesentlich besser abschnitt. Mit Schillers Freigeist hatten schon immer einige politische Instanzen ihre Schwierigkeiten. Ich gebe zu, dies beschäftigte mich noch nachhaltig, als ich einige Tage später wieder auf dem Weg zurück ins Rheinland war. Und ich erinnerte mich daran, dass mich etwas über 20 Jahre zuvor - zu meinem zwanzigsten Geburtstag - an meinem damaligen Studienort ein ungewöhnliches Geburtstagspaket meines Vaters erreicht hatte. Ungewöhnlich vor allem deshalb, weil ich mir damals nicht erklären konnte, wie mein Vater, der als Arbeiter kaum eine Beziehung zu Büchern hatte, auf die Idee gekommen war, mir Schillers gesammelte Werke in einer dreibändigen Dünndruckausgabe des Hanser Verlages zu schenken. Gewünscht hatte ich mir diese Art von Lektüre jedenfalls nicht. Ich hatte mich artig bedankt, diese drei schönen Bände dekorativ ins Regal gestellt und vergessen. Jetzt, zwanzig Jahre später, erinnerte ich mich an sie, nahm den ersten Band zur Hand und begann zu blättern und zu lesen. Da rutschte die Glückwunschkarte, die mein Vater mit seiner schwerfälligen Handschrift und mit wenigen, aber herzlichen Worten an mich adressiert hatte, aus den Seiten. Mein Vater, in seinem 51 Lebensjahr viel zu früh gestorben, war mir plötzlich gegenwärtig wie schon lange nicht mehr. Etwas in mir geriet in Bewegung... Ich brauchte nicht lange und ich las mich in Schillers Texten fest, und als ich mich dann intensiver mit seinem Leben beschäftigte, war es um mich geschehen. Der Wunsch, über Friedrich Schiller zu schreiben, war geboren und er ließ mich über Jahre und Jahrzehnte nicht los. Je älter ich werde, desto mehr fasziniert mich dieser Mensch Friedrich Schiller.
Es war tatsächlich nicht geplant und ein glücklicher Zufall, dass ich ausgerechnet zum 200. Todesjahr Schillers im Jahr 2005 mit der ersten Fassung meines Schiller Romans fertig wurde und dann sofort beim Verlag Langen-Müller in München auf eine begeisterte Lektorin stieß, die sich für das Buch und mich als Autor unglaublich persönlich engagiert hat. Groß angelegte Werbung, Plakate, Flyer und im Verlagsteam immer mehr Schiller infizierte Verlagsmitarbeiterinnen. Man hat mir erzählt, dass der Verlag zur Straße bzw, im Flurbereich einen Schaukasten hat, der mit dem Cover meines Buches geschmückt war. Zum Schillerjahr 2005 dann noch ein Fernsehauftritt im MDR in Magdeburg über eine Stunde im Studio zum Sonderthema "Schiller". Natürlich freute ich mich über diese ungeheuere Resonanz! So etwas hatte ich bislang nur im Sachbuchbereich erlebt - und selbst da wäre es noch etwas ganz besonderes gewesen! Die ersten Besprechungen trafen ein, alle durchweg gut, bis sehr gut. Sogar einige große Frauenzeitschriften gaben Leseempfehlungen! Doch ich behielt Bodenhaftung und blieb skeptisch: Der Verlag titelte selbstbewusst "Schiller/Der Roman"! Natürlich "Der Roman" - es gab aktuell keinen anderen aktuellen über Schillers ganzes Leben. (Foto: Verleihung der französischen Ehrenbürgerschaft an Schiller, Urkunde durch Danton gezeichnet - Foto privat mit Gen. Marbach Ausstellung) Lesenswertes, erzähltes über Lebensabschnitte, ja, aber nicht das Wagnis einer Gesamtschau. Die war bislang nur den großen Biografien und Werken der Literaturwissenschaftler vorbehalten geblieben. Aber ich bildete mir keineswegs ein, einen aus guten Gründen erfolgreichen Rüdiger Safranski, mit seinem "Schiller oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus" oder Bücher, wie Peter-André Alt, "Schiller/Leben, Werk, Zeit in zwei Bänden" oder Sigrid Damm, "Das Leben des Friedrich Schiller/Eine Wanderung", um nur diese aus einem großen Reigen von Neuerscheinungen zu nennen, die 2005 auf den Markt drängten, überflüssig zu machen. Dieses Prinzip eines Heinrich Heine: "Schlage die Trommel und fürchte dich nicht!" hatte ich noch nicht verinnerlicht. Zu sehr war und bin ich mir der Größe dieses Friedrich Schillers und seines Werkes bewusst, auch wenn es mir immer wieder darum geht, erzählend deutlich zu machen, dass er ein ganz normaler, ein leidenschaftlicher, leidender, intensiv lebender und viel zu früh gestorbener Mensch war. Irgendwie kommt man sich als Erzähler, wenn die Maschinerie der Feuilletons sich erst einmal auf die fachlichen Aspekte der Literaturgeschichte eingelassen hat, bei allem bescheidenen Erfolg dann sogar klein und überflüssig vor. Man ist als Romanautor Gefühlen verpflichtet, spielt mit Material, das einmal lebendig war, versucht, Dinge sichtbar zu machen, wo sich der Wissenschaftler vor dem staunenden Publikum an die Brust schlägt und faktenreich ausruft: So war es und wenn es nicht so war, weiß ich wenigstens warum! Das erste persönliche Zusammentreffen mit einem der ganz Großen unter den Schillerexperten aus dem Literaturbetrieb fand für mich dann in Bonn statt. Jemand raunte mir vor der Lesung zu: "Da vorn in der ersten Reihe, das ist Prof. Norbert Oellers von der Uni Bonn. Ich schluckte - sein großformatiges Schiller -Buch war mir während meiner ganzen Romanarbeit ein treuer Ratgeber und Leitfaden gewesen. Da saß ein Experte und ich würde ihm gleich Schiller-Geschichten erzählen... Wenn das nur gut ging! Ich sprach mir Mut zu, erinnerte mich an den jahrelangen Schreibprozess, die eigenen Recherchen. Natürlich würde ich einem, der wie Prof. Oellers in der Schiller Forschung Maßstäbe setzte, nicht wirklich etwas entgegensetzen können. Ich wurde nervös - sehr nervös sogar. Die erste Viertelstunde der Lesung geriet mir eher schlecht als recht. Ich fühlte mich wie in einer Prüfungssituation. Doch dann in der Pause nur ein, zwei Fragen und eine kurze, freundliche fachliche Diskussion darüber, warum ich meinen Schwerpunkt in den Jugendjahren Schillers und wenigstens Seitenzahlen mäßig nicht in der Entstehung seiner großen Werke (etwas über 1/3 des Romans entfällt allein auf Schillers Akademiezeit). Ich erläuterte, wie ich nach der Recherche vorgegangen war, wie ich immer vorgehe. Ich frage mich, was war im Leben dieses Menschen, das ihn so geprägt hat, dass dies aus ihm geworden ist, wo sind seine existenziellen Erfahrungen gewesen, die dazu geführt haben, dass ihm beispielweise das Freiheitsdrama des Wilhelm Tell nur in wenigen Tagen und Wochen (und dies bei seinem schlechten Gesundheitszustand!) aus der Feder geflossen ist, während sich Goethe Jahre lang daran die Zähne ausgebissen hatte und nichts zu Papier brachte. Warum schreibt einer wie Schiller Balladen, wie die Bürgschaft zum Thema Freundschaft und auf diese Weise, um Leben und Tod ringend? Für mich war die entscheidende existenzielle Prägung von Schiller die Drangsal der Tyrannei durch die Anstalten des Herzogs Carl Eugen von Württemberg und seine Errettung durch einen engen, verschworenen Kreis von Freunden. Ein Kind, isoliert von seinen Eltern, aus der vertrauten Umgebung gerissen und unter militärischen Drill gezwungen, wird traumatisiert. Dies ist mein Ansatz für die Erzählung von Schillers Leben geworden und aus diesem Grund dieser biografische, einfühlsame Erzählansatz, der dieser Zeit einen Schwerpunkt einräumt. Prof. Oellers äußerte Verständnis, ich wurde selbstsicherer für die zweite Hälfte der Lesung und bekam am Ende vor vollem Haus auch aus der Expertenecke Applaus.
(c) Udo Weinbörner
10.
Friedrich Schiller und der Blick in die USA
- Die Mehrheit ist der Unsinn! -
„Die Mehrheit ist der Unsinn!“, schrieb Friedrich Schiller in seinem letzten unvollendeten Drama ‚Demetrius‘. Ein ungeheurer Satz! Ein demokratiefeindlicher Satz!
Zum Frühstück eines jeden Diktators zu servieren? Ist er wahr – oder, was ist wahr an ihm? Schiller dachte weiter: Ist die Mehrheit allein der Sinn? Oder sollten etwa Minderheiten den Willen der Mehrheit regieren? Nein, natürlich wäre dieser Umkehrschluss grundlegend falsch. Ebenso falsch, wie es wäre, den Willen der Minderheiten zu übergehen, nur weil die Mehrheit ein Regierungsmandat errungen hat und das Recht zur Machtausübung sich auf ihrer Seite befindet. Die Mehrheit hat auch Hitler gewählt. Relative Mehrheiten führten zu nationalen Irritationen, wie zum Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Gemeinschaft (Brexit) und zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen und internationalen Konflikten, verursacht durch einen amerikanischen Präsidenten Trump in unseren Tagen... Wir erleben schmerzhaft und ohnmächtig, wie eine Mehrheit sich stark fühlt und marschieren lässt, weil sie über eine Befehlsgewalt verfügt. Wir sehen, wie eine Mehrheit mit dem Recht des Stärkeren meint, Minderheiten in den Staub und bis ins Grab treten zu dürfen. Man muss nur den Fernseher einschalten und man bekommt mit den Nachrichten tagtäglich das Erschrecken über die Geist- und Gewissenlosigkeit von Mehrheiten und ihren Repräsentanten in seine Wohnstuben als Bild geliefert.
Die Mehrheit ist der Unsinn! Natürlich hat Schiller recht, wenn er den Demetrius dies sagen lässt. Allein, weil jemand die Mehrheit für ein Mandat, für die Macht errungen hat, beugt man noch nicht die Knie oder senkt das Haupt demütig. Erst, wenn zum errungenen Mandat die sinnstiftende Handlung hinzutritt, wenn die Macht dazu dient, Menschlichkeit und Werte hochzuhalten, wenn die Mehrheit die Macht verantwortungsbewusst auch im Sinne und mit Respekt vor der Minderheit ausübt, kann eine Mehrheit sinnstiftend sein.
Das Ringen um die Mehrheit ist nur der erste Schritt in einer Demokratie und dem folgen andere, wichtigere Schritte. Der Sinn der Mehrheit liegt nur darin, eine durch Mehrheit errungene Macht sinnstiftend auszuüben. Dabei ist es beschämend zu erleben, wie Mehrheiten in den Händen einiger heutzutage enden. Wie in narzisstischer Selbstüberschätzung Mehrheiten für die eigene Machtentfaltung und Repräsentation, schlimmsten Falls, sogar noch für die Selbstbereicherung missbraucht werden. Die falschen Repräsentanten demokratischer Mehrheiten höhlen auf Stammtischniveau demokratische Werte und den Gemeinsinn der Gesellschaft aus. Sie gefährden den Frieden, das gesellschaftliche Miteinander.
Die Antworten nach dem Sinn einer Mehrheit setzen die richtigen Fragen voraus, Fragen nach der Menschlichkeit, nach den Rechten von Minderheiten – und diese Fragen sind seit Jahrhunderten die gleichen geblieben. Die Mehrheit allein macht keinen Sinn. Natürlich hat Schiller schon recht, auch wenn er ein Phänomen wie den amerikanischen Präsidenten nicht gekannt hat.
Wie anstrengend es ist, auf dieses Amerika zu blicken und zornig zu werden. Zornig zu bleiben. Immer wieder dieser Zorn angesichts dieser kindlichen Naivität, dass man mit einer relativen Mehrheit alles rechtfertigen kann und die Wahrheit sogar für sich gepachtet hat. Natürlich ist dieser Zorn anstrengend und selbstgerecht. Denn es gibt in jeder Nachricht tausendfache Beispiele von Menschen, die auch in Amerika den Zorn nicht verdienen. Aber es ist erschreckend zu erleben, wie um einfacher Argumente willen, nur mit dem Recht des Stärkeren andere Meinungen willfährig, im vorauseilenden Gehorsam bereits durch jene unteren Staatsorgane (wie Polizei und Nationalgarde), denen die Ausübung von hoheitlicher Macht im Staate übertragen worden ist, unterdrückt werden. Wie Pressevertreter geschlagen und inhaftiert werden, wie sie an ihrer Arbeit behindert werden, weil die Mehrheit (zurecht) eine Kritik fürchtet. Wir sehen, wie Polizisten inzwischen Schlagstöcke und Gewehre auch ohne Befehl auf Pressevertreter und Demonstranten richten, weil ihnen deren Berichterstattung nicht in das Weltbild passt, das sich die Repräsentanten einer angeblichen Mehrheit auf Stammtischniveau zurechtgezimmert haben.
Es ist anstrengend, zornig zu sein. Anstrengend, weil man nur mahnen kann, zusieht und hilflos verschlissen wird.
Wie weiter?
Schreiben …
Was mich beschäftigt: Ich habe einen Sohn, der auf Hawaii lebt und eine Schwiegertochter dort, die wegen ihrer Hautfarbe und ihrer Lebenserfahrung den Unsinn einer Mehrheit um den amerikanischen Präsidenten Trump durchaus persönlich nimmt und Schiller, den sie wahrscheinlich nie gelesen hat, durchaus verstehen würde. Das Erstaunliche dabei: Sie lacht und wirkt unbeschwerter und dennoch engagiert.
Wenn nicht schreiben …
Dann wenigstens daran sollte ich arbeiten, an meinem Lachen und dem Leben. Eben.
© Sommer 2020
11. Vergangenheit und Zukunft - Erzählung -
Früher, in meiner Jugendzeit, begann es schon im September zu regnen. Die ersten Wibbelbohnen landeten aus dem Garten auf dem Tisch und wurden von mir mit Verachtung gestraft. Die Sauerkrauttöpfe wurden geöffnet und seltsame Gerüche kündigten endgültig Herbst und Winter an. Die Alten raunten, dass man den Tod ums Haus schleichen hörte, wenn bei Dunkelheit ein Käuzchen rief. Ich war ganz sicher, es saß in den Spitzen einer der riesigen Tannen dort am Waldrand, auf die man aus dem Schlafzimmerfenster schaute und beklagte wie ich den Verlust der Sonnentage. Bald würden Eisblumen an den Doppelglasscheiben wachsen und Holzscheite zusätzlich zu den Briketts, die wieder teurer geworden waren, im Ofen knistern. Wenn man den mittleren der eisernen Ringe aus der Herdplatte hob und mit dem Eisenhaken zur Seite schob, malten die Flammen zum sonoren Klang des alten Röhrenradios ‚Nordmende‘ oder ‚Grundig‘ Licht und Schattenspiele an die Decke und die Wände. Opa Wilhelm, aus der Zeit gefallen und zum Nichtstun verdammt, lauschte jeden Abend für Stunden, wie es in der Welt da draußen zuging. Er pflegte seine Rituale: am Morgen das Blatt des christlichen Tageskalenders, der griffbereit an der Wand neben der Tür zum Schlafzimmer hing, der Nachmittag gehörte dem ‚Südländer Tageblatt‘, der Tageszeitung, deren Worte mit einer Leselupe besonderes Gewicht bekamen und ab 18:00 Uhr sein Radioprogramm. Samstags und sonntags kamen einmal im Monat die Lektüren des ‚Evangelischen Sonntagsblattes‘ hinzu. Nie machte er sich über die Rätsel her, die ältere Menschen stets zu lieben pflegten und, was er las, blieb unkommentiert. Man ließ ihn gewähren, es fragte ihn auch niemand. Opa war ein Fels in der tosenden Brandung meiner untergehenden Sommersonne und der heraufziehenden Herbststürme, die uns mit bunten Blättern die ganze Pracht und Herrlichkeit der Natur vor unsere Füße warfen.
Es war die Zeit der ersten schwarz-weiß-Fernseher und man erfuhr über Mode und Prominenz vieles, was bislang niemanden interessiert hatte und im Grunde auch völlig bedeutungslos war. Doch abends wurden die Augen weit und die 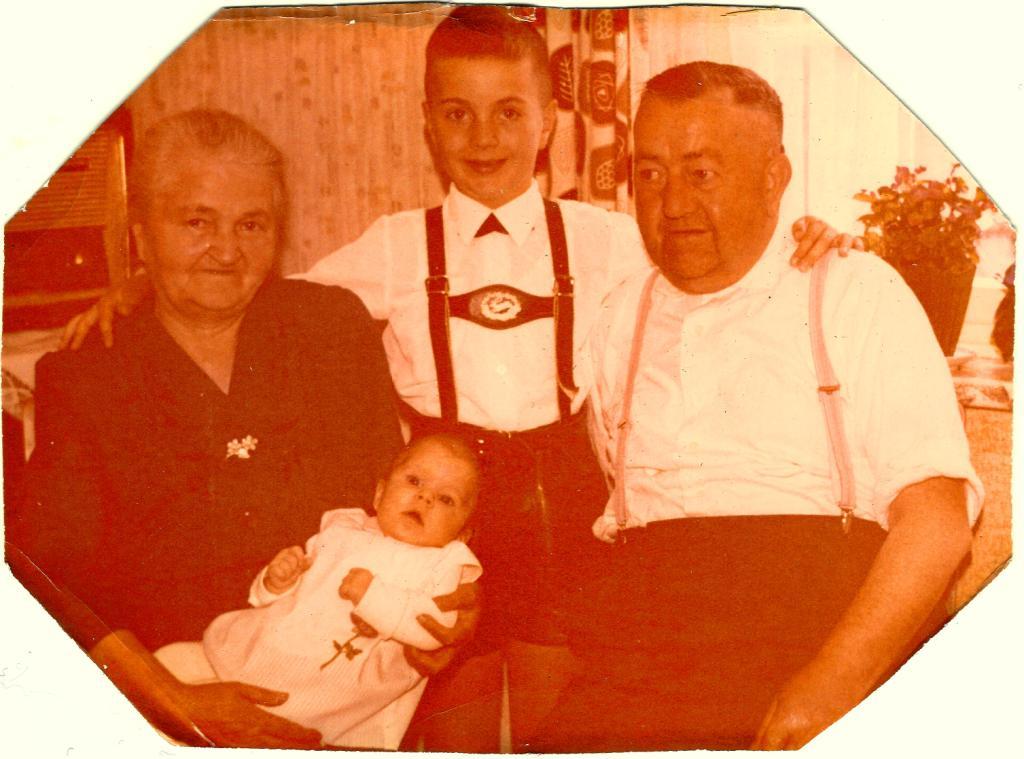 Blicke sehnsüchtiger. Auch wenn die Bilder, die in die Wohnstuben flimmerten, noch schwarz-weiß waren, ließen sie doch das Leben jenseits der Stadtgrenzen bunter erscheinen und verursachten Herzweh danach, mehr zu fordern vom Leben, als einen täglich gedeckten Tisch und das Dach über dem Kopf. Es reichte nicht mehr aus, niemandem etwas schuldig zu bleiben und deshalb von jedermann respektvoll gegrüßt zu werden, bald galt jener etwas, der aufbrach, kaufte, investierte und nach mehr strebte. Ein jeder sein kleiner Wirtschaftswunderunternehmer des Glücks. Füllten sich auch die Schränke mit neuen modischen Kleidern, wusch und wienerte ein jeder auf dem Bürgersteig vor seinem Haus am Samstag seinen neu erstandenen Wagen, der ganz neue Freiheiten versprach, das neue Glück hielt jedoch nur kurz und wurde stets mit einem Strauß neuer Kosten und Verpflichtungen erkauft, die wieder ein Stück der Lebenszeit einforderten. Wenn man nicht darauf achtete, konnten Begehrlichkeiten einem mächtig die Flügel stutzen.
Blicke sehnsüchtiger. Auch wenn die Bilder, die in die Wohnstuben flimmerten, noch schwarz-weiß waren, ließen sie doch das Leben jenseits der Stadtgrenzen bunter erscheinen und verursachten Herzweh danach, mehr zu fordern vom Leben, als einen täglich gedeckten Tisch und das Dach über dem Kopf. Es reichte nicht mehr aus, niemandem etwas schuldig zu bleiben und deshalb von jedermann respektvoll gegrüßt zu werden, bald galt jener etwas, der aufbrach, kaufte, investierte und nach mehr strebte. Ein jeder sein kleiner Wirtschaftswunderunternehmer des Glücks. Füllten sich auch die Schränke mit neuen modischen Kleidern, wusch und wienerte ein jeder auf dem Bürgersteig vor seinem Haus am Samstag seinen neu erstandenen Wagen, der ganz neue Freiheiten versprach, das neue Glück hielt jedoch nur kurz und wurde stets mit einem Strauß neuer Kosten und Verpflichtungen erkauft, die wieder ein Stück der Lebenszeit einforderten. Wenn man nicht darauf achtete, konnten Begehrlichkeiten einem mächtig die Flügel stutzen.
Doch es waren die Zeiten, in denen das Wachstum gepredigt und gelebt wurde. Die Menschen auf dem Land versammelten sich vor den Flimmerkisten, die bald bunte Bilderträume zeigten und süchtig machten. Manchmal an einem Samstag sprach man von früher und beschwor die alten, harten Zeiten, feuerte, nachdem der Wagen gewaschen und der Garten hinter dem Haus winterfest bestellt war, spät am Abend noch einmal den Holzkohlegrill an und zu dem Schweinefleisch auf dem Grillrost und zum wärmenden Feuer mit den Gartenabfällen rösteten Kartoffeln schwarz in der glühenden Asche. Diese Zeit vor dem letzten Feuer des Jahres und den Aschekartoffeln, liebte ich sehr.
Mir wuchsen Schmetterlinge im Bauch, ich träumte von einer Liebe, davon, dass mir die Tage nicht nur verstreichen mochten und wie abgerissene Kalenderblätter zu Boden fielen. Sie sollten zu einem Leben voller besonderer Tage werden, an die ich mich – mit jedem einzelnen Tag – noch viele Jahre erinnern könnte. Ich wollte keine austauschbare Gegenwart, suchte nach einer Daseinsberechtigung, die man sich nicht allein mit Schwielen auf dem Hintern als Erbe ersitzen konnte. Doch die dunklen Tage des heraufziehenden Herbstes brachten zu den Schmetterlingen im Bauch zunächst die ersten Rotznasen und Hustenanfälle. Wie der Wind den Regen an die Doppelglasscheiben trommeln ließ und das Echo der im Tal durchrauschenden Züge des Nachts, wenn alles endlich schlief, verstrichen meine Tage doch allzu oft gesichtslos. An diese große Sehnsucht, an mein Lauschen und Grübeln, daran erinnere ich mich noch.
Kleine und große Geheimnisse. Wir lebten direkt am Wald, aus dem uns Kindern keine wilden Tiere mehr bedrohten und der später für erste heimliche Liebeschwüre eine verschwiegene Kulisse bot. Wenn nicht der Wind, uns den Regen, den Schnee und die dunklen Wintertage vor die Fenster und die Herzen geblasen und diesen Heimlichkeiten im Wald ein Ende bereitet hätte ... Große Dinge gerieten mir hier einfach zu klein, doch ducken wollte ich mich nicht, sondern stark werden, dort, wo der Mangel Ausdauer und Fantasie erforderte. Der Dachboden wurde ausgebaut. Ich entdeckte vor den Ziegeln zwischen doppelten Wänden eine wurmstichige Gitarre ohne Saiten und eine alte, verdreckte Zither, die man dort zum Sterben hin verdammt hatte. Groß war meine Verwunderung, denn niemand in der Familie musizierte und zu keiner Zeit hatte ich jemanden von einem Instrument sprechen gehört. Eine Spur zu einem Geheimnis, das ich in diesem Haus mit seinen ausgefegten Ecken nicht zugetraut hätte. Statt einer Auskunft, nur die Aufforderung, die Gitarre möglichst umgehend im Mülleimer draußen zu entsorgen. Holzwürmer könne man in der Stube nicht gebrauchen. Dem hatte die Männerwelt nichts hinzuzufügen und die Frauen im Haushalt gaben sich beschäftigt. Die Entschiedenheit der Forderung ließ mich aufhorchen. Ganz sicher gab es noch eine Geschichte dazu, über die niemand sprechen wollte. Die Zither blieb mein Beweisstück und meine sichtbare Forderung nach einer Erklärung. Am Abend vor dem Radio das verträumte Lächeln meines Großvaters, der mir sogar kleine schwarz-weiß Fotografien aus einer vergangenen Zeit präsentierte. Er inmitten einer Schar von Männern mit Gitarren , Zithern und einem Akkordeon. Nein, er vermisse die Musik nicht, das sei schon so in Ordnung. Sein rechtes Ohr wieder an den Radioapparat gepresst, als er auf der Skala mit dem großen Drehknopf rechts am Radio einen neuen Sender einstellte. Ich könne die Zither behalten, wenn es mir Freude bereiten würde. Ein paar Jahre hatte er sogar musiziert in diesem Kreis. Mehr erfuhr ich nicht von ihm. Was hatten sie gespielt? Waren sie aufgetreten? Es gab keine weiteren Erklärungen und Hinweise mehr. Nur diese fünf kleinen Fotos und dieses Instrument, das zumindest meiner Oma ein Dorn im Auge war, die es am liebsten gleichfalls entsorgt gesehen hätte.
Vater erkrankte im November. Es war kalt in den Fabrikhallen geworden. Die Ohrenentzündung mochte nicht mehr abklingen, trotz der Ohrentropfen. Der Arzt durchstach das Trommelfell und Vater blieb auf einer Seite schwerhörig. Die Erkältungen setzten ihm zu und er schleppte sich zur Arbeit. Ich steckte meine Nase in Bücher, mit schlechtem Gewissen, denn naseweiß weiß alles besser und verdient doch nichts. Er bekam von meiner Mutter ‚Hausrezeptverordnungen‘. Zu schlecht riechenden Einreibungen, ein rohes Ei in billigen Weißwein geschlagen als Zaubertrank. Er nahm davon nur, wenn es mit reichlich Zucker und Honig für ihn genießbar und wirkungsvoll zusammengerührt wurde. Er blieb auch später dabei. Nur Weißwein (wenn überhaupt und kein Bier verfügbar war als Ausnahmefall), wenn dieser mit Zucker gesüßt war. Wenn ich davon erzähle, lachen wir noch heute darüber. Dabei bin ich sicher, dass sich auch dahinter eine Geschichte verbarg, über die niemand sprach und nach der niemand gefragt hatte. Eine Geschichte, wie so viele Herbstgeschichten hierzulande, die, wenn man von ihnen erfuhr, zu ernst ausfielen, als dass man es noch gewagt hätte, über den Zucker im Wein zu lachen. Ich lernte damals, wenn einmal meine Zeit gekommen wäre, dass ich alt und krank würde, sollte ich mich, solange man mir noch in den Weißwein Zucker und Honig rührte, über den mir erwiesenen Liebesdienst freuen. Zucker und Honig halfen immer irgendwie im Leben weiter.
Seit ich diese Fotos von dem Mandolinenclub besaß und wusste, zu wem die Zither gehörte, hockte ich immer öfter in der Wohnküche meiner Großeltern und quälte die wenigen verbliebenen rostigen Saiten des durch Feuchtigkeit, Kälte und extreme Hitze ziemlich gebeutelten Instruments mit meinen Spielversuchen. Auch ein Lieblingsenkel konnte zuweilen auf die Nerven gehen, insbesondere, wenn dieser bei seiner Anwesenheit stets und andauernd einen lauernden Blick aufsetzte und – selbst für Schwerhörige unüberhörbar – schräge Töne anschlug. Oma strich sich häufiger als gewöhnlich über ihre schwarze Kittelschürze und ließ ihr: „Ach Gottchen, nee“, vernehmen. Opa legte seine Leselupe zur Seite und sah mich interessiert an, als habe er etwas in mir entdeckt, was er lange verloren geglaubt hatte. Meine Mutter nahm mich nach Tagen schließlich zur Seite und versuchte sich mit einer Erklärung, die mich friedlich stimmen sollte. Die Instrumente habe Oma Martha aus reiner Fürsorge verschwinden lassen, denn eigentlich sei Opa Wilhelm längst gestorben. Es quäle ihn sehr, wenn man ihn wieder an die Musik erinnere und ich ihn ständig mit der Nase darauf stieße.
„Gib endlich Ruhe“, bat sie mich. Ich verstand diesen seltsamen Zusammenhang nicht und empfand die Eigenmächtigkeit ungeheuerlich, sah in dem abendlichen Ritual des Opas vor dem Radio plötzlich nur noch einen erzwungenen Ausschluss von dem Fernsehabend, an dem Wilhelm als einziger nie teilnahm. Was hatte der arme Mann verbrochen? Konnte man ihn deshalb des Nachts noch im Flur bei geschlossener Schlafzimmertür drinnen im Bett vor dem Einschlafen jeden Tag laut und deutlich beten hören? Leistete er Abbitte für schwere Sünden?
Ein Schwindel hätte ihn befallen, Kopfschmerzen, dann sei er innerhalb einer Woche zwei Mal bewusstlos zusammengebrochen, was bei seiner Arbeit im Walzwerk gefährlich gewesen sei. Ich sah die riesigen Hochöfen, die tonnenschweren Blechpakete, die über Rollen zu den Walzen gezogen wurden, die großen Krananlagen vor mir, hörte im Geist, wie so häufig in meiner Kindheit, die Werkssirene außerhalb der üblichen Schicht- und Pausenzeiten aufheulen, wenn man Hilfe rief, die Arbeit unterbrach und anzeigte, dass es einen Unfall gegeben hatte. Kaum einer der Männer mit den von der Hitze der Hochöfen aufgequollenen Körpern erlebte – falls überhaupt - seine Rente mehr als drei, vier Jahre.
Und Opa war krank – nein, nicht nur das: Eigentlich, versicherte mir Mutter, dürfte er schon längst nicht mehr leben. Er sei so krank, dass selbst die flimmernden Bilder des Fernsehers und die Strahlen, die von der Kiste in unserer Wohnstube ausgingen, ihm schaden würden. Die Krankengeschichte erzählte mir mein Vater am Wochenende, denn er hatte Opa mit dem Zug auf dem Weg nach Düsseldorf zur Untersuchung – hin und zurück – begleitet. Man habe Luft in seinen Kopf gepumpt, ihn geröntgt und einen Gehirntumor festgestellt. Opa habe sich gegen eine Operation entschieden, dessen Risiko auch den Ärzten damals hoch erschien und war mit dem sicheren Todesurteil nach Haus gefahren. Wenige Monate, höchstens ein halbe Jahr habe ihm damals der Professor noch gegeben. Es folgte ein trauriger frühzeitiger Abschied aus dem Arbeitsleben mit düsteren Aussichten.
Doch dort, wo der ärztlichen Kunst natürliche Grenzen gesetzt waren, begann die wundersame Heilkraft der ‚Hausmittelrezepturen‘, die noch manchen hoffnungslosen Fall kuriert hatte. Sie war vor allem dort besonders gelobt, wo sie der Medizin verborgen blieb und mit den Empfehlungen des Hausarztes, der von solchen Dingen nichts studiert hatte, nicht überein kam.
Details der Behandlungsansätze wurden nicht verraten und ausgerechnet das hochwirksame gezuckerte Weinrezept war auch nicht zum Tragen gekommen, da jegliche Form von Alkohol wegen der Gefahr des einhergehenden Schwindels und als Körpergift bei solch schwerwiegenden Fällen verpönt war. Martha verordnete ihm häusliche Gleichförmigkeit, kappte alle seine Aktivitäten, setzte ihn zur Ruhe und auf Fernsehentzug, halbierte seine heißgeliebten Bratkartoffelportionen. Bier und Zigaretten gab es überhaupt nicht mehr, nur noch kleine Spaziergänge und keine großen körperlichen Anstrengungen. Aufregungen gestattete sie ihm nur noch, wenn sie mit ihm den Kopf zurechtrückte. Um alle anderen Dinge des Lebens, vom Einkauf bis zur Sparkasse, kümmerte sich Martha allein. Kein Kaffee, nur noch ‚Omas berühmte Natobrühe‘ (Malzkaffee) mit viel Milch. Sahne nur an hohen Feiertagen und auch nur ein winziger Klecks. Opa Wilhelm, willig und gutmütig bis auf die Knochen, wurde als Mann so unsichtbar, dass der Tod ihn glatt übersah, er nach dieser Todesdiagnose noch nahezu zwanzig Jahre ohne größere Beschwerden mit seinem Tumor lebte und wahrscheinlich auch eher an Hausrezepten und einem zu eintönigen Radioprogramm gestorben ist.
Einmal mit der Suche nach Antworten begonnen, wollte ich die Zusammenhänge tiefer verstehen und fragte Opa Wilhelm trotzdem, ob er beide Instrumente, Gitarre und Zither, gut beherrscht habe. Er lächelte und antwortete nur: „Ich habe sogar Mandoline und Mundharmonika ganz ordentlich gespielt.“ Ich verstand nicht, dass er die Musik nicht vermisste, aber er zuckte nur gleichgültig mit den Schultern. Es sei gut, dass er jetzt wisse, was aus den Instrumenten damals geworden sei, aber die Sache mit der Musik sei doch schon so lange her. „Mir geht es gut“, versicherte er und brachte mir von seinem nächsten kleinen Spaziergang aus dem nahen Einkaufsmarkt („wo er längs gegangen war“) einen Spielplan der deutschen Mannschaft für die Fußballweltmeisterschaft mit, damit ich im Fernsehen auch kein Spiel verspasste.
In diesen Herbsttagen lernte ich, dass das meiste im Verhalten von Menschen in der Vergangenheit seinen Grund hatte. Kaum etwas ergab sich so zufällig oder derart selbstverständlich, wie es äußerlich schien. Es waren diese Geschichten aus der Vergangenheit bei Paaren, die zusammen alt wurden, die sich während eines Lebens auf eine Art so untrennbar miteinander verflochten, dass noch nicht einmal das alte Paar selbst mehr von dieser Geschichte erzählen könnte. Doch, wenn man um die Geschichte weiß, sind ihre Auswirkungen im Verhalten spürbar.
Opa Wilhelms Duldsamkeit und Überlebenswille erschienen mir überirdisch. Der Totgeweihte, der überlebte – bekam in meiner Fantasie etwas übermenschlich Heldenhaftes, während er den Männern und Frauen im Haushalt zu häufig nur im Weg zu stehen schien. Dann erwischte ich ihn, als er heimlich eine Zigarette rauchte, die ihm ein alter Nachbar auf seinem Spaziergang anbot. Ich verriet nichts, wurde zu seinen Komplizen. Seine Verfehlung bewirkte bei mir zweierlei: Einerseits zeigte sie mir, dass er keineswegs ohne zu Leiden Verzicht übte auf so viele Dinge, die ihm im Leben etwas bedeutet hatten. Dieses Leiden und seine kleine Sünde machte ihn andererseits einfach menschlicher.
„Wilhelm, du hast geraucht! Wo hast du die Zigaretten her?“
Er ging langsam an ihr vorbei, Martha blieb an seiner Seite, ihr Mund ganz nah an seinem Ohr. Er wandte sich ihr zu, lächelte verlegen wie ein ertappter Pennäler: „Ach, da war doch nichts.“
„Da schafft man, macht sich Sorgen, hält alles zusammen … Und der Herr sagt: Da war doch nichts!“, Marthas Stimme gewann an Schärfe. „Ach Gottchen, nee, wie kann ein Menschenskind nur so undankbar sein. Du weißt genau, wie gefährlich das für dich ist, wenn du nicht auf dich achtgibst! Warum machst du so etwas? Ich verstehe dich nicht, Wilhelm!“
Gegen ihren Redeschwall kam er nicht an. Reden konnte sie wohl schon immer besser als er, da wuchs sie, klein, wie sie mit ihren 1,63 Meter war, über sich hinaus. Außerdem hatte sie Publikum, neben mir betrat auch jetzt meine Mutter die Wohnküche, die sich ohne viel zu fragen sofort mit Martha verbündete und schließlich mutmaßte: „Das war bestimmt wieder der alte Bolte. Fehlt nur noch, dass er dich auf ein Bier und Schnäppsken in die Klause einlädt. Der macht sich doch einen Spaß draus, weil er weiß, wie sehr uns das aufregt.“
„War es der Bolte? Sag schon! Der hat kein Gewissen! Und du tust ihm noch den Gefallen, Wilhelm!“, setzte Martha weiter nach. Die beiden Frauen hingen an ihm wie ein wild gewordener Wespenschwarm. Wilhelm taumelte durch die Wohnküche Richtung Eckschrank mit Radioapparat wie ein angeschlagener Boxer. Ich wusste, dass es der Bolte gewesen war und konnte mir durchaus vorstellen, dass die Frauen mit ihren Vermutungen über dessen Motive der Wahrheit schon recht nah kamen. Andererseits, wer hatte schon einen Totgeweihten in seiner Familie, der mittels strengster Hausrezepturen sein Todesdatum für Jahrzehnte überlebte? Ein Mann, wie der Bolte, der unbekümmert drauflos lebte und seiner Angetrauten in schönster wöchentlicher Regelmäßigkeit mit einem ordentlich Rausch in die Stube torkelte und es sich zum Hobby gemacht hatte, im Sommer jungen Pärchen im Wald hinterherzuschleichen, mochte zwar unter dem gleichen Sauerländer Himmel leben, aber er blickte gewiss auf einen anderen Horizont. Der konnte und wollte Wilhelms Lebensumstände nicht annähernd verstehen. Wilhelm seinerseits schwieg hierzu, nannte weder jetzt seinen Namen, noch hörte ich ihn überhaupt einmal schlecht über Bolte reden. Dies überließ er unkommentiert den Frauen.
„Es war doch nur eine halbe Zigarette! Und die hat er noch nicht einmal zu Ende geraucht“, es war an der Zeit, dass jemand Partei für Opa ergriff.
Schon schoss sich die Weiblichkeit auf mich ein. „Du warst wohl dabei? Hast nichts gesagt, nichts verhindert?“ Doch ich hatte meine Lektionen gelernt, wusste mich zu wehren, ohne dabei zuviel preis zu geben. Opa ließ sich in seinen Sessel fallen, griff nach dem Tageblatt und seiner Leselupe, obwohl es noch zu früh dafür war, gab vor, angestrengt zu lesen und lächelte mir in einem passenden Moment verschwörerisch zu.
Der Glaube an die Wirkungen von Hausrezepten führte in weiten Teilen zu Ritualen, wie sie in Religionen im Zusammenhang mit Bußübungen üblich waren. Eine Sünde wurde mittels einer Strafe und einem harten, schmerzlichen Verzicht aus der Welt geschafft. Der Umgang mit Bolte, ja, jeder Spaziergang nur in dessen Nähe, wurde Wilhelm untersagt. Man gab sich entschlossen, mit einer Beschwerde bei den Frauen in Boltes Haushalt vorzusprechen und eine Beachtung dieses in der Nachbarschaft peinlichen Umgangsverbots einzufordern. Die ohnehin schon knapp bemessene Portion an Bratkartoffeln (Opas Lieblingsgericht) wurde bis auf weiteres noch einmal halbiert. Das Fett galt einfach als zu ungesund. Dies traf ihn am meisten, und ich bemerkte ein Zucken um seine Mundwinkel.
Als ich ihn am Abend vor seinem Radio wieder aufsuchte, hatte sich der Rest der Familie im Wohnzimmer im ersten Stock um den Fernseher versammelt. Opa zog ein längliches Rezept aus seiner Westentasche und gab es mir zu lesen. Es handelte sich um eine alte Verordnung eines Professors von der Düsseldorfer Universitätsklinik. Tabletten und Tropfen. Die Dosierungsanordnung hatte der hochgelehrte Mediziner in lateinischen Zahlen unter dem Namen des jeweiligen Medikaments vermerkt. Opa hatte nach den Kosten für die Medikamente und nach den Nebenwirkungen gefragt, sich dankbar gezeigt für die Ausführungen des Herrn Professors, aber das Rezept nie in einer Apotheke eingelöst. „Immer, wenn es mir schlecht ging, habe ich es aus der Tasche gezogen, die komplizierten Namen der Medikamente buchstabiert und die lateinischen Zahlen für die Anzahl der Tabletten und Tropfen gelesen. Dies hat ganz gut geholfen. Komisch nicht? Und nun schau mal im Flur nach, ob wir ungestört sind.“
Erst jetzt bemerkte ich die Pfanne auf dem Herd, auf dem Martha die Reste von Bratkartoffeln warm hielt, unter dem Vorwand, man dürfe kein Essen wegwerfen, dies sei eine Sünde. Opa und ich, wir beide, wussten genau, dass es nur ein Vorwand war, denn jeden Mittag landete ein Teil von Marthas Tellerinhalt in den Flammen des Kohleofens. Warum? Dies wäre schon wieder eine andere Geschichte, um die es hier noch nicht gehen soll. Wilhelm machte sich mit Heißhunger über den Rest in der Pfanne her, ließ aber noch eben genug übrig, um im Fall des Falles behaupten zu können, dies sei der Rest gewesen. Dann schlurfte er mit raschen Schritten zurück in seine Radioecke, winkte mich zu sich heran und lächelte zufrieden.
„Weißt du, sie meint es nicht so, kann es nicht richtig zeigen, dass sie zu mir gehört. Aber mir hat sie schon immer gefallen.“ Dann schaute er lange aus dem Fenster auf die Straße und die sonore Stimme des Radios überbrückte das Schweigen. Ich war mir nicht sicher, ob er überhaupt hinhörte. Ich sprach ihn schließlich auf das Kriminalhörspiel an. Er nickte nur: „Ihre blauen Augen werden ganz groß, wenn sie mit mir schimpft. Wenn sie sich Sorgen macht, ist ihr Gesicht fast so schön wie früher. Aber das sage ich ihr so natürlich nicht. Dabei ist es mir nach all den vielen gemeinsamen Jahren noch immer wie ein Wunder, dass sie einfach mit mir gegangen ist und ich sie aus Hessen hierher habe bringen können. Wir haben ein gutes Leben, Junge.“
Keine Frage sollte mir damals die friedlich dämmrige Stimmung trüben. Dabei war der Anfang der eigentlich beeindruckenden Geschichte noch nicht einmal erwähnt worden, der mit dem Tod von Marthas Mutter im Kindbett bei der Entbindung ihres letzten von zu vielen Kindern begann. Martha musste damals um die vierzehn Jahre alt gewesen sein, als sich ihr Vater für seinen Haushalt und die Kinderschar eine neue Frau nahm, weitere Kinder bekam. Martha, als eine der älteren Töchter, wurde auf einem entfernten Bauernhof verdingt. Für dieses Mädchen, durch den Tod der Mutter ohnehin traumatisiert, jetzt auch noch von den Geschwistern getrennt und mit der Gewissheit, zu Haus nicht mehr willkommen zu sein, aus der gewohnten Lebensumgebung gerissen, begann ein harter, arbeitsreicher Überlebenskampf. Traumatische Erlebnisse, die meine Oma bis ins hohe Alter prägen sollten. Dort traf sie nach Jahren auf Wilhelm, der ebenfalls aus einer kinderreichen Familie ohne eine Mutter im Haushalt stammend, einen Leiterwagen für die auf Bauernhöfen verdienten und erbettelten Lebensmittel und mit seinen paar Habseligkeiten hinter sich herzog und Richtung Hessen unterwegs war, getrieben von der Hoffnung, nicht mit leeren Händen wieder zu Haus aufzukreuzen. Wie die beiden auf dem Bauernhof in der Nähe von Hersfeld zueinander gefunden haben, weiß ich bis heute nicht, aber Wilhelm hat sich ein Herz genommen und sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, im Sauerland einen Männerhaushalt mit seinem Vater und den Geschwistern zu führen. In dem Leben, das ihr aufgezwungen worden war, konnte sich Martha manches vorstellen. Sie kannte ihn nicht, schnürte ihr Bündel und ging mit. Es dauerte nicht lange, bis sie Wilhelms Leben nach ihren Vorstellungen umgekrempelt und selbst durch die Kriegsjahre auf solide Bahnen gelenkt hatte.
Ich hockte ganz still in der gegenüberliegenden Ecke der Wohnküche bei dem warmen Ofen und beobachtete, wie Wilhelm zerstreut zur Zeitung griff, obwohl die Radiosendung noch lief. Er hielt die Leselupe verkehrt herum und die gedruckten Worte ergaben keinen Sinn. Dann schaltete er den Radioapparat aus, legte die Zeitung beiseite, seufzte tief und schaute durch das Fenster in die Dunkelheit. „Ob sie heute wohl früher runter kommt? Was meinst du? Sie ist mir doch sicher nicht mehr böse.“
Für den Bruchteil eines Augenblicks erfasste ich, was es bedeuten konnte, zu lieben und geliebt zu werden, getragen von einer Liebe, die einem für Jahrzehnte sogar das Leben retten könnte. Ich antwortete etwas Belangloses, wünschte ihm noch eine „Gute Nacht“ und ging auf mein Zimmer. Mir war klar, dass nur den wenigsten von uns allen gelingen würde, was meine Großeltern im Ansatz bis ins Alter verband. Aber mein Wunsch war riesengroß, es mit aller Ernsthaftigkeit zu versuchen. Ein Jahr, nachdem Wilhelm gestorben war, ist ihm Martha nachgefolgt. Ohne ihn fehlte ihr der Lebenswille.
(c) 2020

'Blick riskieren' - Anne und Udo Weinbörner, Aufnahme Udo Weinbörner, 2018










